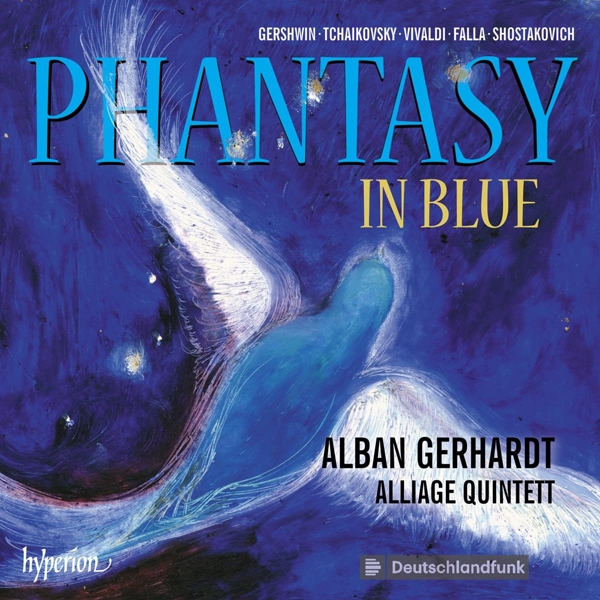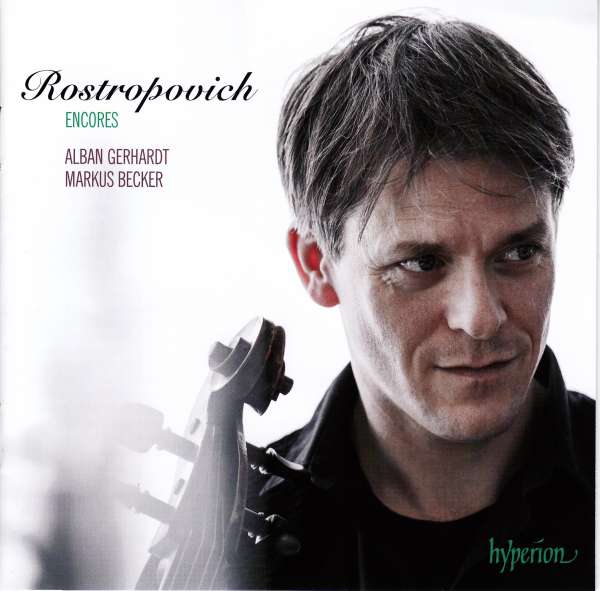Mit Alban Gerhardt Musik zu hören ist ein Erlebnis. Mal hört der 1969 in Berlin geborene Cellist ganz aufmerksam zu, ohne etwas zu sagen. Dann wieder sagt er voraus, was gleich passieren wird. Er hat immer die Noten parat, um seine eigene Auffassung zu belegen. Rennt los, um eine eigene Aufnahme zum Vergleichen zu holen (die er genauso kritisch beleuchtet wie fremde: „Ich vibriere da für meinen Geschmack auch zu viel“ oder: „Da sind wir auch viel zu langsam“ ). Oder er spielt gleich auf dem Cello vor, wie man es nicht machen soll und wie er es sich stattdessen vorstellt. Die Begeisterung für die Musik reißt ihn mit – jede Aufnahme, denke ich oft, würde er am liebsten als Anlass nehmen, sich gleich wieder selbst an diese Musik zu machen.
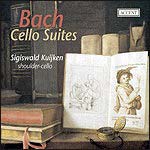
Bach: Cellosuite Nr. 6, Präludium
Sigiswald Kuijken (Schulter-Cello) 2009
Accent
Was ist das – ein Barockcellist, der auf einem „cello piccolo“ spielt? Ein Schulter-Cello! Jedenfalls klingt es etwas dürftig. Sobald er auf die tieferen Saiten geht, hat das Instrument gar keine Sonorität mehr. Ein Barockcellist wie Anner Bylsma ist dagegen unglaublich klangvoll. Und rein musikalisch finde ich die Aufnahme eher unbefriedigend: Das ist fast wie ein Springtanz gespielt. Man kann beinahe ein Metronom danach stellen. Das ist natürlich Ansichtssache, aber gerade Barockcellisten spielen diese Bachpräludien ja ziemlich frei. Ich habe mit diesem Stück mal Unterricht bei Walter Levin gehabt. Und der hat gesagt, dass alle Bachpräludien wie große Fantasien seien und auch so gespielt werden sollten. Wie eine sehr fantasievolle und freie Einleitung. Das hier ist dagegen ganz streng. Und die Artikulation ist ein bisschen stereotyp (stellt die Aufnahme ab). Das geht dann wohl auch so weiter. So wurde Bach früher oft gespielt. Mit einer geistigen Unfreiheit im Kopf und ohne eigene Kreativität. Deswegen habe ich diese Musik nicht gemocht. Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich eine ganz eigene Meinung habe, wie das gespielt werden soll. Wenn ich das Stück nicht kennen würde, würde ich diese Art zu spielen vielleicht akzeptieren.
 Haydn: Konzert C-Dur, 3. Satz
Haydn: Konzert C-Dur, 3. Satz
Sol Gabetta (Violoncello)
Kammerorchester Basel
Sergio Ciomei (Leitung) 2009
Sony Classical
Das hört man jetzt oft: Die Solisten spielen mit einem Barockorchester, wissen aber nicht, was sie machen sollen. Dann kommt erst so ein non-vibrato-Ton, und dann holen sie doch den romantischen Klang heraus. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ein kleiner Ton ohne Tiefe. Ist das Sol Gabetta? Das Orchester artikuliert gut, aber sie bleibt die ganze Zeit in der Saite drin. Sie spricht nicht. Gleichzeitig fehlt auch der große Klang – dann muss man es machen wie Rostropowitsch, der artikuliert auch nicht, aber er badet im Klang. Hier klingt es niedlich und verspielt, ohne echte Substanz zu haben. Aber das ist auch ein sehr schweres Stück. Ich habe sie für ihren Mut bewundert, diesen dritten Satz bei der Echo-Preisverleihung zu spielen. Der ist so gefährlich. Ich habe das Konzert neulich aufgeführt: Das ist wie ein Ritt auf einem Vulkan. Es ist natürlich sehr sauber und mit schönem Ton musiziert, aber ich habe vor einiger Zeit Daniel Müller-Schott mit diesem Stück gehört – der macht das sehr viel besser.
 Haydn: Konzert D-Dur, 1. Satz
Haydn: Konzert D-Dur, 1. Satz
Emanuel Feuermann (Violoncello)
Symphony Orchestra
Malcom Sargent (Leitung) 1935
Naxos
Das ist ja süß – jetzt macht das Orchester wieder Tempo – und der Cellist besteht auf seinem. Aber ein guter Klang, schön in der Saite. Keine Ahnung wer das ist – ein Franzose? Ich rate mal – ist das Feuermann? Das wurde damals alles live aufgenommen und war gleich perfekt. Ich habe mal Norbert Brainin vom Amadeus-Quartett eine Beethoven-Sonate vorgespielt, und der ist eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, hat er gesagt: Sie erinnern mich an Emanuel Feuermann. Weil ich damals noch wie ein alter Cellist gespielt habe. Das war genau meine Klangvorstellung: Dieses sehr intensiv in der Saite spielen, mit eher engem Vibrato. Mein Lehrer Boris Pergamenschikow hat dann versucht, mehr „Wind“ in den Ton zu bringen. Das ist jedenfalls mit ganzem Herzen so gespielt, wie Feuermann denkt, dass es sein soll. Was bei Sol Gabetta vielleicht auch interessanter wäre: Wenn sie nicht mit einem Barockorchester spielen, sondern voll romantisch loslegen würde. – So habe ich auch lange Barockmusik gespielt, limitiert, ohne wirklich barock zu sein, weil man denkt: Man darf nicht richtig. Wir Streicher sind halt gewohnt zu vibrieren. Und wenn man das Vibrato „abstellt“, stellt man oft auch den rechten Arm aus.
 Walton: Cello-Konzert, 1. Satz
Walton: Cello-Konzert, 1. Satz
Daniel Müller-Schott (Violoncello)
Oslo Philharmonic Orchestra
André Previn (Leitung) 2006
Orfeo
(nach einem Takt) Oh, ich liebe das Stück. (hört lange zu) Und ich weiß schon, wer das ist, der gefällt mir mit Haydn besser. Das ist zuviel Aufwand. Und es ist leider 15 Schläge zu langsam. Das richtige Tempo ist, glaube ich, 66, das Orchester tupft nur so und das Cello legt sich dann oben drauf. (spielt vor) – Das machen die Cellisten immer: Sie versuchen alle wie verrückt, die leeren Saiten zu vermeiden, aber wenn sie dann auf das a in der fünften Lage kommen, spielen sie es als Flageolett. Wie im zweiten Thema vom Brahms- Doppelkonzert. Finde nur ich das doof? Die vibrieren erst wie die Weltmeister, und dann kommt dieses Flageolett. Das muss doch dieselbe Farbe behalten. Aber er spielt natürlich super Cello. – Man muss nicht stupide dem Metronom folgen. Aber man muss doch versuchen zu verstehen, was der Komponist für ein Gefühl haben wollte. Hier ist das so ein schwebendes Gefühl. Nicht „rumpumpum“, sondern über der Erde, ganz luftig. Aber ich glaube, alle Aufnahmen sind in diesem zu langsamen Tempo. Neulich hat das jemand bei mir im Unterricht auch so gespielt. Ich hatte das Stück fünf Jahre nicht gemacht und habe dann das Metronom rausgeholt, um zu gucken, ob ich spinne, aber es stimmte. Die spielen 54, und das Stück bekommt dadurch etwas sehr Elegisches. Aber in der Partitur steht 66-69. Das Konzert wird vielleicht auch deswegen so selten gespielt, weil schon Piatigorsky das Stück breiter angelegt hat, so dass es ein bisschen langweilig wird.
 Walton: Cello-Konzert, 1. Satz
Walton: Cello-Konzert, 1. Satz
Gregor Piatigorsky (Violoncello)
Boston Symphony Orchestra 1957
RCA
Das ist schon spannender, oder? 20 Schläge schneller. Müller-Schott ist der bessere Cellist, musikalisch macht es bei Piatigorsky mehr Sinn. Aber wer bin ich, dass ich weiß, wie‘s „richtig“ ist? Klar, Piatigorsky ist der Widmungsträger. Nur, darauf kannst du nicht bauen. Das ist wie bei den Komponisten: Sind die ihre besten eigenen Interpreten? Sie können es sein, aber in dem Augenblick, wo sie am Dirigierpult stehen oder am Instrument sitzen, sind sie genau denselben Zwängen und Problemen ausgesetzt wie jeder Interpret: Er spielt und merkt gar nicht genau, was er macht. Dieses sich von oben Beobachten und Wissen, was man gerade macht, ist schwierig.
 Schostakowitsch: Cellokonzert, 3. Satz/2. Satz
Schostakowitsch: Cellokonzert, 3. Satz/2. Satz
Han-Na Chang (Violoncello)
London Symphony Orchestra
Antonio Papanno (Leitung) 2005
EMI
Sehr gut! – Super, wie sie den Tempowechsel hier machen. Das war ein bisschen hart, hatte aber einen guten Zug. Dieses Konzert ist ja gar nicht so schwer, aber der Solist ist einfach super gut zusammen mit dem Orchester. Das ist oft ein Problem bei diesem Stück. Hören wir mal den langsamen Satz. – Das fängt so wunderschön an – das Vibrato auf dem a ist toll – und dann kommt er auf den dritten Finger und macht sowas! Jeder Finger hat ein anderes Vibrato. Anfangs ist das die perfekte Farbe, wie bei einem Gebet, schöner kann man das gar nicht spielen. Und dann kommt dieses Schlackern rein. Schade, der hört sich nicht zu. Das ganze könnte mehr Legato haben, und das Tempo ist auf der langsamen Seite. Aber das ist bisher der beste Cellist. Auch dynamisch ist das viel flexibler als in den Beispielen bisher. Han-Na Chang? Erstaunlich! Ich dachte erst beim dritten Satz, es wäre Capuçon. Den habe ich noch nie gehört, aber alle erzählen, dass er ziemlich laut und sehr gut spielt. Aber der langsame Satz ist sehr sensibel musiziert. Jetzt ist das Tempo wieder besser – das ist ja unbarmherzig schnell, was Schostakowitsch vorschreibt. 66! Und das hier ist gut 50. Das muss wohl an der Aufführungstradition liegen. Rostropowitsch spielt, glaube ich, noch langsamer. Aber das gefällt mir gut. Die Jury soll ja geweint haben, als Han-Na Chang mit elf Jahren beim Rostropowitsch-Festival gespielt hat.