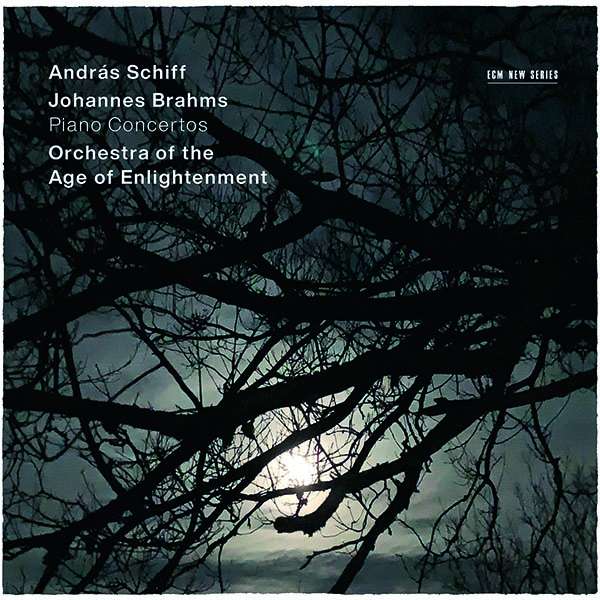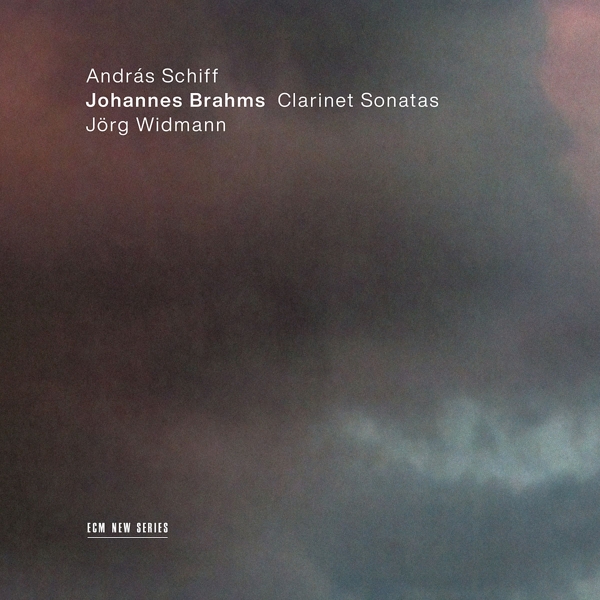Konzentriertes Halbdunkel. In der Solistengarderobe der Elbphilharmonie brennt nur eine kleine Tischlampe. Ob das für unser Gespräch ausreiche, fragt Sir András Schiff. In rund neunzig Minuten wird er die jungen Pianistinnen Martina Consonni und Tomoki Park im Rahmen seines Programms „Building Bridges“ präsentieren.
Herr Schiff, stimmt es, dass Sie jeden Tag mit Musik von Bach beginnen?
András Schiff: Ja. Zu Hause spiele ich zuerst auf dem Clavichord, weil es diesen schönen, leisen Klang hat. Nach dem Frühstück wechsle ich zum Flügel.
Beeinflusst das Spiel auf dem Clavichord Ihre Interpretationen auf dem Konzertflügel?
Schiff: Enorm! Die Tasten des Clavichords haben kaum Widerstand, und weil es kein Pedal gibt, muss man alles mit den Händen machen. Der Interpret kann sich nicht verstecken. Im Gegensatz zum Cembalo kann man aber mit sehr differenzierten dynamischen Feinheiten arbeiten. Was man auf dem Clavichord lernt, kann man wunderbar auf moderne Instrumente übertragen.
In letzter Zeit begeben Sie sich auch mit anderen Komponisten in den Bereich der historisch informierten Aufführungspraxis, etwa mit Schubert …
Schiff: … bis hin zu Brahms. Ich möchte jetzt auch auf Chopin zurückkommen, den ich sehr lange gemieden habe, weil ich mit meinem Spiel unzufrieden war – bis ich auf einem Pleyel-Flügel aus Chopins Zeit gespielt habe. Da eröffnete sich mir eine ganz andere Welt.
Und wie hört sich ein historischer Brahms an?
Schiff: Seine Musik wird heute sehr fett und groß ausgestellt. In einer Brahms-Sinfonie spielen achtzig bis neunzig Leute. In Meiningen unter Hans von Bülow musizierten nur 42. Das ist eine veritable Alternative, wobei es natürlich auch darauf ankommt, wo man spielt. Man sollte niemals dogmatisch sein.
Haben Sie deshalb mit der Cappella Andrea Barca 1999 Ihr eigenes Kammerorchester gegründet? Weil Sie auf der Suche nach dem luziden Klangbild waren, für das kleinere Orchester die besseren Voraussetzungen mitbringen?
Schiff: Das könnte man so sagen. Wobei meine Cappella auf modernen Instrumenten spielt. Sie ist kein historisches Ensemble, aber wir sind historisch informiert. Von dieser Bewegung kann und sollte man sehr viel lernen.
Wie groß ist die Bereitschaft unter Musikern und Dirigenten, dies zu tun?
Schiff: Die meisten Musiker großer Sinfonieorchester sind heute zwar sehr gut, aber auch sehr einseitig ausgebildet. Sie sind nicht neugierig, sondern nehmen die Dinge so, wie sie sind. Die großen Geister der historischen Aufführungspraxis wie Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt oder John Eliot Gardiner sind viel kultivierter und belesener als die meisten Star-Dirigenten oder Solisten. Warum können diese nicht auch die Violinschule von Leopold Mozart lesen? Dann würden sie Mozarts Violinkonzerte nicht seit 150 Jahren mit den falschen Betonungen und Verzierungen spielen. Und warum lesen Pianisten nicht die Klavierschule von Carl Philipp Emanuel Bach? In einer idealen Welt treffen historische und gegenwärtige Spielarten ohne Dogmatismus aufeinander.

In Ihrer langen solistischen Laufbahn haben Sie nahezu alle wichtigen Klavierwerke aufgeführt und eingespielt. Gibt es für Sie noch etwas zu entdecken?
Schiff: In der Tat habe ich fast alles, was mich fasziniert, auch gespielt – mit einer Ausnahme: Debussy. Das scheint vielleicht überraschend, und ich fürchte auch, dass mir die Zeit dazu fehlen wird, das nachzuholen. Zumal ich nicht mehr daran arbeite, mein Repertoire zu erweitern, sondern es bewusst reduziere.
Eine Konzentration auf das Wesentliche? Gibt es die auch bei Bach?
Schiff: Ich habe vor Kurzem – ganz bewusst erst nach meinem siebzigsten Geburtstag – „Die Kunst der Fuge“ öffentlich gespielt. Das ist wirklich ein Mount Everest, so einmalig und fantastisch, dass das Werk mich begleiten soll, solange ich atme.
Sie sagten einmal, schon als junger Mann konnten Sie die meisten Noten von Beethovens „Hammerklaviersonate“ spielen, hatten aber keine Ahnung von deren künstlerischer Idee. Heute sei es umgekehrt. War das nur ein Bonmot?
Schiff: Keineswegs. Heute verstehe ich die musikalischen Zusammenhänge viel besser als damals. Aber rein physikalisch ist das Spielen viel schwieriger geworden. Es geht noch, ich beklage mich nicht, aber ich werde vieles reduzieren und langsam aber sicher auch aufhören, mit Orchester zu spielen. Darauf verzichte ich sehr gerne, obwohl mir die Klavierkonzerte von Mozart fehlen werden. Die spiele ich dann mit meiner Cappella und konzentriere mich mehr auf Kammermusik und Solowerke, bei denen ich allein verantwortlich bin.
Warum wollen Sie das Spiel mit fremden Orchestern aufgeben?
Schiff: Das Verhalten der Musiker stört mich oft. Manche sind sympathisch, aber andere schauen mich gleich so schräg an. Wieder andere gucken ständig auf die Uhr, weil sie auf das Ende der Probe warten, und die Blechbläser lesen die Fußballzeitung. Bei allem Respekt: Muss das sein?
Haben sich die Orchester oder hat sich Ihre Wahrnehmung verändert?
Schiff: Die Orchester haben sich verändert. Das gilt nicht für meine Cappella, für das Chamber Orchestra of Europe, das Orchestra of the Age of Enlightenment oder das Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer, mit dem ich oft zusammenspiele. Aber selbst er muss seine Musiker bei einer Probe x-mal ermahnen, endlich mit dem Plaudern aufzuhören. Die Disziplin hat nachgelassen.
Woran liegt das?
Schiff: Ich unterrichte viel und gerne – auch Kammermusik – und begegne vielen jungen Instrumentalisten, die mit strahlenden Augen voll Begeisterung bei der Sache sind. Aber kaum spielen sie in einem Profiorchester, erlischt dieses Licht. Traurig, nicht wahr? Warum ist das so? Man muss sich anpassen. Natürlich ist es etwas Wunderbares, in einem Orchester zu spielen. Aber nur als Solist und Kammermusiker bestimme ich selbst mein Repertoire und suche mir die Menschen aus, mit denen ich zusammenspielen möchte.
Vor zehn Jahren riefen Sie das Programm „Building Bridges“ ins Leben, mit dem Sie junge Pianisten fördern, die gerade anfangen, sich eine Karriere aufzubauen. Welche Förderbausteine beinhaltet das Programm?
Schiff: Jedes Jahr werden drei Pianistinnen und Pianisten gefördert, die ich als Mentor begleite. Diese stellen eigenständig ein Programm zusammen, mit dem sie ihre stärksten Seiten zeigen. Das ist sozusagen ihre Visitenkarte. Dann versuchen wir, für die Teilnehmer Auftrittsmöglichkeiten zu finden. In dieser Spielzeit sind es acht bis zehn Konzerte in verschiedenen Städten. Was sich daraus entwickelt, liegt in den Händen der jungen Musiker.
Als Sie selbst jung waren, sollen Sie Glenn Gould einmal Ihre Interpretation von Bachs „Goldberg-Variationen“ vorgespielt haben. Stimmt das?
Schiff: Indirekt. Ich habe ihn zusammen mit Gidon Kremer nach unserem Duo-Konzert in Toronto besucht. Er wohnte damals in einem Hotel. Zwei Tage zuvor hatte ich die „Goldberg-Variationen“ aufgeführt, und Gould hatte die Radio-Übertragung gehört. In ein Konzert wäre er niemals gekommen, weil er diese Form der Musikdarbietung hasste. Aber er fand toll, dass ich die Wiederholung der 18. Variation eine Oktave tiefer gespielt habe. Es war eine sehr schöne, berührende Begegnung. Leider auch die letzte, weil er wenige Monate später gestorben ist.
Am 21. Dezember haben Sie Ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert. Haben Sie an dem Tag Klavier gespielt?
Schiff: Ja, ich habe in Berlin ein Konzert mit den sechs Bach-Partiten gegeben. Geburtstage bedeuten mir nicht viel.