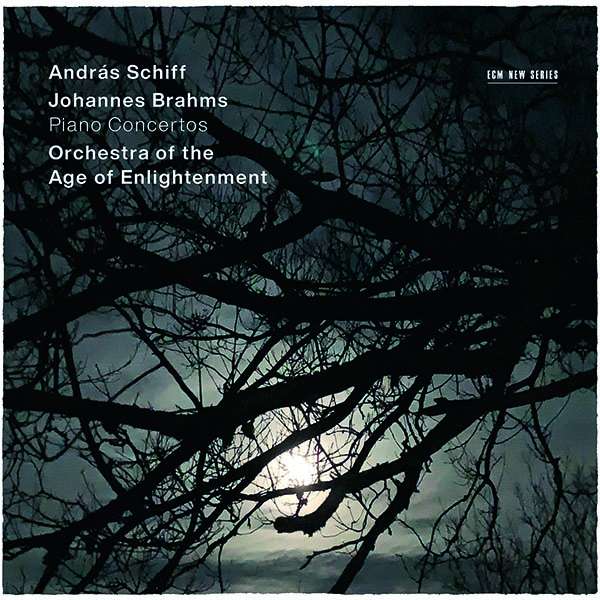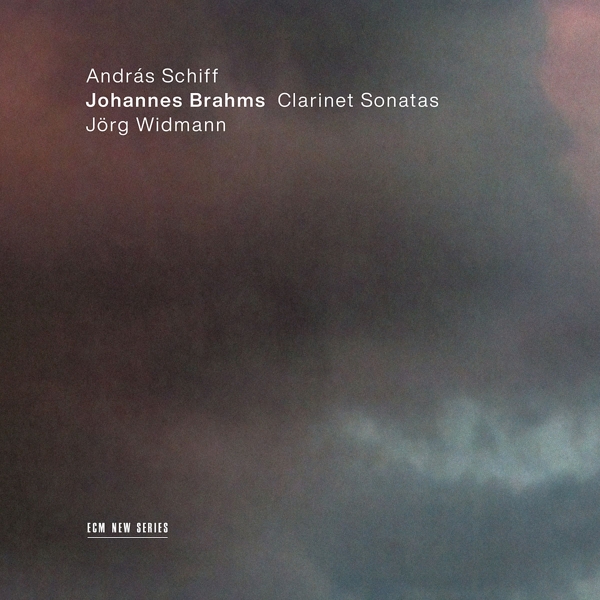Sir András Schiff gilt als der Intellektuelle unter den Pianisten, als nachdenklicher Analytiker, der sich gern zyklisch in die Werke Bachs, Beethovens, Schuberts und anderer Großer versenkt. Sein Spiel ist jedoch alles andere als trocken. Auch im Gespräch erweist sich der 58-jährige Ungar, der in London und Florenz lebt, als Mann mit feinem Humor. Seinen ruhig und in dezentem Tonfall gesprochenen Sätzen, die er aus einem frappierend großen deutschen Wortschatz schöpft, schickt er manchmal ein geradezu schelmisches Lächeln hinterher.
Herr Schiff, ist Bach der größte Komponist?
Ja. Das steht für mich außer Frage. Es gibt andere großartige Komponisten, aber die wären alle einverstanden. Haydn, Mozart, Beethoven, Bartók – sie kommen alle von Bach. Bach kommt natürlich auch irgendwoher, aber das ist schwerer zu definieren. Bach verkörpert den Gipfel der europäischen Musikgeschichte, und seitdem kamen noch weitere große Berge hinzu.
Und in ihnen allen suchen Sie die Spuren von Bach.
Es stimmt, ich suche die Bachsche Ur-Linie in den Komponisten. Liszt zum Beispiel hat meiner Meinung nach wenig mit Bach zu tun, und mit Liszt, Berlioz, Wagner habe ich wenig zu tun, ich mag diese Musik nicht besonders.
Hängt das mit Ihrem Studium zusammen?
Ja, ich bin schwer beschädigt aus meiner Jugend. An der Franz-Liszt-Musikhochschule tönte aus jedem Zimmer Liszt, meist sehr schlecht gespielt. Das ist nicht die Schuld von Liszt, ich sehe heute ein, was für wunderbare Werke er geschrieben hat. Aber eine tiefe Antipathie ist geblieben. Brendel und Barenboim haben mir stundenlang gepredigt, ich müsse Liszt spielen. Doch ich bin stur geblieben. Wir haben solch ein Riesenrepertoire, da muss jeder sich etwas aussuchen – ohne sich zu spezialisieren. Ich spiele sehr viel. Aber einiges eben nicht: Nichts von Liszt, nichts von Rachmaninow, nichts von Ravel, den ich sehr bewundere, aber er wärmt mein Herz nicht.
Spielen Sie jeden Tag Bach?
Jeder Tag beginnt mit einer Stunde Bach. Das ist ein Ritual. Präludien und Fugen, Partiten, Suiten, egal was. Mit 18 Jahren habe ich aufgehört mit technischen Übungen. Ich fand das menschenunwürdig, diese Etüden und Tonleitern, stundenlang. Das ist wie Holzhacken, das hat mit Musik nichts zu tun. Bachs Musik ist komplett, da ist alles drin inklusive diesem Teil, dass ein Mensch, der aufsteht und noch müde und steif ist, sich intellektuell, emotional und physisch lockert. Bach am Morgen ist wie ein Seelenbad.
Ist Ihnen Bach immer leicht gefallen?
Bei Bach habe ich mich immer wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Sehr viele Musiker sagen, es falle ihnen schwer, Fugen zu lernen. Ich fand das nie, das ist Glücksache. Die Fuge aus Beethovens Hammerklaviersonate ist ein sauschweres Stück, aber wenn man sein Leben lang sehr strenge Bachfugen gespielt hat, dann ist die viel freiere Beethovensche Fuge relativ einfach.
Sie haben sich nacheinander intensiv mit Bach, Mozart, Schubert, Beethoven beschäftigt. Warum erarbeiten Sie die Werke einzelner Komponisten so gern zyklisch?
Aus Neugierde. Es interessiert mich einfach, nicht nur einzelne Werke zu studieren, sondern das Ganze. Davon profitiert das einzelne Werk. Alles hängt mit allem zusammen, die einzelnen Gattungen im Werk eines Komponisten, die Werke seiner Zeitgenossen und Vorgänger, die Geschichte, die anderen Künste, die Philosophie, die Wissenschaft. Das hört nie auf.
Lesen Sie viel?
Unglaublich viel. Ich gehe leidenschaftlich gern ins Museum, in Bibliotheken, ins Kino, ins Theater. Ich sammle Inspiration und Impulse.
Was genießen Sie mehr: das Konzert oder das Studium der Werke?
Beides ist schön. Ich mag die Analyse sehr, ich mache auch gern Lectures. Aber ein Konzert soll ein Erlebnis sein. Besonders schön finde ich manche Konzerterlebnisse mit Bach, weil die Bachische Musik es schafft, eine Gemeinde zu bilden zwischen Bach, den Interpreten und der Zuhörerschaft. Wie ein Gottesdienst im besten Sinne. Diese Musik zieht einen nicht herunter, sondern erhebt einen, sie erfüllt einen mit positivsten Gedanken. Die Winterreise ist ein erschütterndes Erlebnis, es ist schwer, danach noch frei zu atmen. Bei Bach ist das anders.
Gottesdienst klingt so ernst.
Bach hat auch Humor. Er ist oft wie ein Bauer, verwurzelt in der Erde. Das schönste ist, dass diese zwei Welten, das Sakrale und das Säkulare, wunderbar koexistieren. Im Wohltemperierten Klavier gibt es passionsartige Sätze und in der Matthäus-Passion Tanzsätze. Bei Bach kommen Intellekt und Emotion zusammen, und sogar eine Freude an der Beweglichkeit. Das Tänzerische des Barock ist auch bei Bach immer da.
Ohne Spielfreude geht es nicht?
Die ist sehr wichtig. In fast allen Sprachen „spielt“ man ein Instrument, im Englischen, Französischen, Ungarischen, Russischen. Nur das italienische suonare kommt von Ton. Die Sprache zeigt uns, dass das spielerische Element eine wichtige Rolle spielt. Wer kann am besten spielen? Ein Kind. Das Kindliche, Spielerische müssen wir uns bewahren, auch wenn wir im Laufe des Lebens viel lernen und Ernst, Tiefe und andere Dimensionen hinzukommen. Ich habe immer die alten Meister bewundert, die das Kindliche und eine Altersweisheit zugleich in sich haben.
Wie wichtig ist Ihnen die Person Johann Sebastian Bach?
Wichtig. Aber leider oder Gott sei Dank wissen wir unglaublich wenig über Bach. Da kann man spekulieren. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie dieser Mensch bei so einer Familie mit so vielen Kindern – die sind ja wild – so ruhig arbeiten konnte. Seine Handschrift ist wunderbar klar, da gibt es kaum eine Korrektur. Zudem hat er sein Leben lang von französischen und italienischen Meistern gelernt und kopiert. Er war nie außerhalb Deutschlands und doch bestens vertraut mit der Musik Europas. Das ist wirklich unglaublich. Gut, es heißt oft, dieses oder jenes Werk stamme nicht von Bach. Aber jemand hat all diese Werke geschrieben. Wenn die h-Moll-Messe jetzt von Herrn Johann Schmidt stammt, dann ist Johann Schmidt der größte Komponist der Geschichte. Aber ich glaube doch, sie stammt von Bach.
Dass man so wenig von Bach weiß – gibt Ihnen das mehr Freiheiten?
Dass wir so ein unglaublich lebendiges Bild von Schubert oder Beethoven haben, ist eine große Hilfe, aber auch eine Beschränkung. Bei Bach muss man viel mehr Vorstellungskraft und Phantasie haben, um lebendig zu musizieren und etwas aus diesem Notenbild zu erschaffen, aber diese Freiheit ist auch toll. Eine Bachische Fuge kann sehr überzeugend gespielt werden in sechs verschiedenen Tempi, in sechs verschiedenen Charakteren. Wenn Sie dagegen bei einem Mozart-Klavierkonzert das Tempo nur ein bisschen falsch nehmen, dann spürt jeder musikalische Mensch sofort, da stimmt etwas nicht, das atmet nicht richtig. Bei Bach ist die Toleranzgrenze viel weiter, was Dynamik, Artikulation, Tempi, Tonfall betrifft.
Piotr Anderszewski hat mir kürzlich gesagt: Bach hat solch eine Suite an einem Tag geschrieben – und ich ringe monatelang um die Interpretation.
So ist es eben. Bach war ein einmaliges Genie. Und es war eine andere Zeit. Bach hat nicht auf die heilige Inspiration gewartet, er musste jeden Sonntag eine Kantate abliefern. Wenn man heute ein neues Werk spielt, kann es passieren, dass man den letzten Teil erst am Morgen vor dem Konzert bekommt. Aber niemand kennt es, und es muss heute erklingen. Wenn man eine Englische Suite spielt, sind die Erwartungen andere. Ich teile das Dilemma. Vielleicht haben wir manchmal zu viel Respekt. Aber zu viel Respekt ist besser als zu wenig.
Selbst die Gestaltung Ihrer Konzertprogramme überlassen Sie den Komponisten: Funktionieren denn die Französischen Suiten am besten in der Reihenfolge von 1 bis 6?
Wenn man so einen Bach-Zyklus macht: ja. Es ist sehr wichtig, danach die großeFranzösische Ouvertüre zu spielen, weil man nach so vielen relativ intimen Stücken ein großes, repräsentatives Werk braucht. Bei den Beethoven-Sonaten bin ich nach langem Nachdenken zu dem Ergebnis gekommen, dass die chronologische Reihenfolge am meisten überzeugt. Man kann Beethovens Evolution folgen, die Werke unter einer Opusnummer bleiben zusammen. Aber ich entwerfe auch sehr gern Programme. Das ist eine Kunst wie das Kochen. Ein Programm sollte nie bloße Unterhaltung sein. Die Leute sollen sich wohlfühlen, das ist mir sehr wichtig, aber ich will es mir und ihnen nicht zu leicht machen.
Wenn Sie mehrere Wochen lang nur Beethoven oder Bach spielen, kommt da nicht irgendwann der Punkt, an dem Sie sagen: Jetzt muss ich mal was anderes spielen?
Sechs Wochen nur Beethoven ist nicht zuviel. Wenn die Musik so gut ist, ist das kein Problem. Da bin ich ein Snob, ich spiele nur gute Musik.
Haben Sie noch einen großen Zyklus vor sich?
Nein. Vielleicht ist wirklich eine Lebensphase vorbei. Das ist ein gutes Gefühl, ich langweile mich überhaupt nicht. Ich werde weiterhin Bach und Beethoven spielen, ich lerne gerade die Diabelli-Variationen, die ich nie gespielt habe. Und ich bin dabei, die Kunst der Fuge zu studieren. Aber ich bin noch nicht sicher, ob das überhaupt ein Konzertprogramm wird. Ich möchte viel mehr Schumann spielen, auch Debussy beschäftigt mich sehr. Ich möchte mehr neue Musik spielen, ich möchte mehr dirigieren, aber nicht zu sehr. Von den zeitgenössischen Komponisten schätze ich Kurtág am meisten, letztens habe ich in Salzburg ein Stück von ihm uraufgeführt. Musik von heute fasziniert mich, aber es ist nicht meine Muttersprache. Es dauert lange, bis ich ein neues Stück gelernt habe. Aber das macht nichts.
Sie machen das aus Freude an der neuen Musik?
Manchmal fühle ich mich schon schuldig, dass ich nicht mehr Neues spiele. Aber ich warte auf Stücke, wo ich mit Leib und Seele dabei sein kann. Am liebsten wäre ich Komponist, nur habe ich dafür leider wenig Talent. In der Literatur, im Film, in der Musik muss es weiter gehen. Was wir am meisten brauchen, sind großartige neue Werke. Allerdings: Musik muss leben. Ein Bild hängt in der Gemäldegalerie, und jeder kann es sich anschauen. Musik muss zum Klingen kommen, sonst lebt sie nicht.
Werden Sie künftig mehr dirigieren?
Es ist wie eine Epidemie, wir Pianisten wollen alle dirigieren. Es macht auch viel Spaß. Ich bin über die Klavierkonzerte von Bach, Mozart, Beethoven zum Dirigieren gekommen. Ich habe immer leidenschaftlich Kammermusik gespielt, und ich habe mein eigenes Kammerorchester gegründet, um vergrößerte Kammermusik zu spielen. Aber es ist ein sehr mysteriöser Beruf, dieses Dirigieren. Es ist eine psychologische Arbeit mit Menschen – das ist wunderbar. Aber für den Orchesteralltag fehlt mir die dicke Haut, und ich bin überhaupt kein Diktator. Ich brauche einen Klangkörper, mit dem ich gut kooperieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich mehr dirigieren werde. Aber nicht, dass ich aufhöre, Klavier zu spielen.