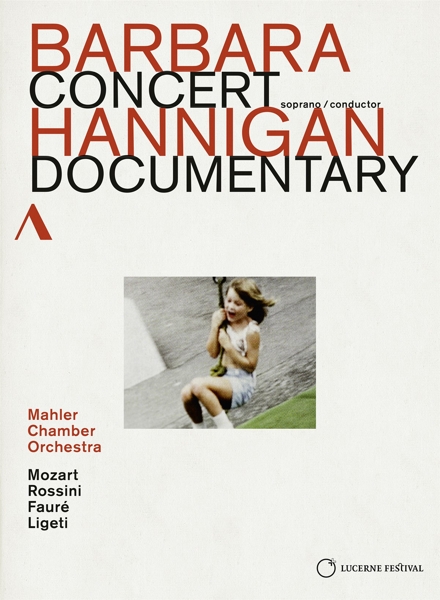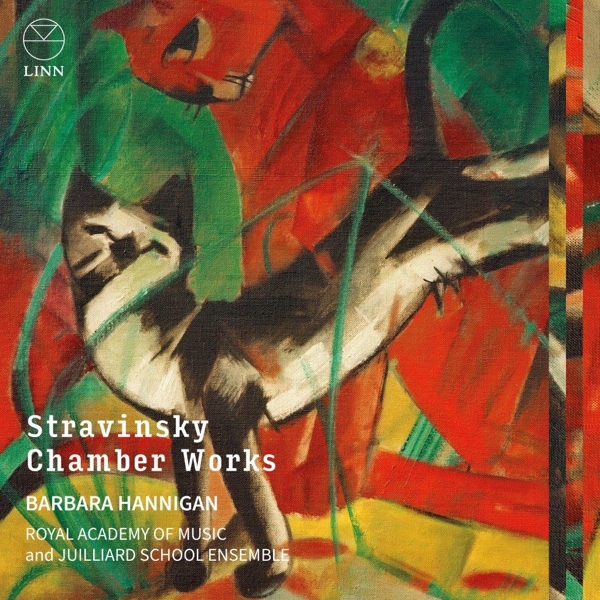Wenn man mit einer Sängerin und Dirigentin ein Interview führt, kommt man schnell auf berufliche Zweigleisigkeiten zu sprechen. Im Falle Barbara Hannigans müsste man aber von Dreigleisigkeit sprechen, hat die Künstlerin doch ihr eigenes, in vielerlei Hinsicht umfangreiches Förderprojekt „Equilibrium“ („Balance“, „Ausgeglichenheit“).
Was bedeutet für Sie das Wort „Equilibrium“?
Barbara Hannigan: Es ist ein sehr wichtiges Wort für mich. Ich habe meine Rede für das Luzerner Festival 2014 so genannt. Und als ich 2017 mein Mentorenprogramm für die jungen Künstler gründete, wusste ich, dass genau dieses Wort am besten zu meinem Projekt passte.
„Begabungen sind produktive Gleichgewichtsstörungen“, schreibt der Aphoristiker Hans Kudszus.
Hannigan: Er hat natürlich recht. In der Musik geht es auch nicht darum, die Balance zu erreichen. Aber als Sänger ist man ständig dabei, die Atmung, die Klangstütze, die Stimme, die Dynamik, die eigenen Emotionen in eine Balance zu bringen.
Harmonie muss also, wie die alten Griechen es sagten, erst errungen werden.
Hannigan: Genau! Sie stellt sich nicht von selbst her. Sie entsteht aus These und Antithese. Das ist oft ein kräftezehrender Prozess, doch wenn er gelingt, ist man der glücklichste Mensch. Auch im Leben müssen die organisatorischen Dinge zusammengebracht werden. Und das ist oft sehr viel anstrengender als in der Musik: Die Kommunikation mit den Agenten der Orchester oder den Solisten, mit den Veranstaltern und Produzenten. Alles scheint oft so kompliziert, ständig muss man hinterher sein.
Liegt darin der Grund, weshalb Sie auf Ihrer Equilibrium-Website klare Vorstellungen formulieren, wie Künstler, die zu Ihnen kommen, sein sollten?
Hannigan: Ich arbeite von sechs Uhr früh bis Mitternacht, dazwischen kommen noch meine Auftritte. Ich will keine Zeit verschwenden, keine Musik machen, die ich nicht will. Ich rufe auch nicht zum Casting auf, sondern suche Musiker, die natürlich, neugierig, fleißig, aufgeschlossen und flexibel sind und über die adäquate Stimme und Technik verfügen.
Sie haben mit Jackie Reardon sogar einen Coach engagiert.
Hannigan: Sie war früher eine professionelle Tennisspielerin. Und wir haben auch eine Yoga-Lehrerin. All das, was im Sport wichtig ist, gilt auch für die Musik: Ausdauer, Konzentration, Disziplin, Fehlerbehebung, Spitzenleistung, aber auch Entspannungs- und Meditationstechniken. Erst wenn ein Projekt präzise vorbereitet und organisiert ist, der Rahmen klar gezogen ist, die Regeln festgelegt sind, dann erst eröffnet sich Raum für Improvisation.

Viele glauben, die Improvisation selbst sei die Musik. Die musikalische Expressivität sei wie ein Vulkan, der ausbricht und die Lava hinabströmen lässt …
Hannigan: Das klingt natürlich genialischer. Doch der Strom muss aufgefangen und zu einem Weg gebündelt werden. Andernfalls führt er ins Nirgendwo oder ins Chaos. Selbst bei einer Konzertkadenz oder im Jazz folgt man bestimmten Regeln. Die Solo-Improvisationen entfalten sich im Rahmen vorher festgelegter Patterns und Absprachen, etwa darüber, wann die anderen Instrumente wieder einsetzen. Ligetis „Le Grand Macabre“ mag wie eine Improvisation klingen, aber in Wahrheit ist alles genau einstudiert und eingespielt. Genau das ist die große Kunst.
Wie bekommen Sie den Impuls, auf der Bühne zu singen, mit dem Schweigen als Dirigentin in Balance?
Hannigan: Daran musste ich mich gewöhnen, dass ich als Dirigentin keinen unmittelbaren Klang selbst auslöse, sondern dies mit Gesten erreiche. Als Solistin, die von einem Dirigenten geführt wird, nehme ich dessen Energie auf und gebe sie weiter. Als Dirigentin wiederum sammle ich die Energien des Orchesters, um selbst welche aufzubauen. Es ist wie ein Kreislauf. Letzten Endes geht es bei beiden Aufgaben ums Atmen. Beim Sänger genauso wie beim Dirigenten.
Lassen Sie uns über Miss McEwen sprechen …
Hannigan: … meine Musiklehrerin aus der Grundschule! Sie ist jetzt in Pension. Ich habe sie im November in meiner kanadischen Heimat bei Meisterkursen gesehen. Sie sieht immer noch genauso aus wie damals! Heute erst verstehe ich, was für eine gute Lehrerin und Musikerin sie war. Sie verstand es einfach, die Menschen für die Musik zu begeistern.
Was nicht immer einfach ist in einer Schulklasse.
Hannigan: Nein, absolut nicht! Sie brachte uns unterschiedliche Sichtweisen der Musik bei. Wir hörten etwa Beethovens fünfte Sinfonie und mussten dann auf einer weißen Tafel deren Energie nachzeichnen. Wir lernten, dass Musik nicht nur aus irgendwelchen Noten besteht, sondern sich in Grafiken übersetzen lässt. Sie setzte mich auch an die Seite von Kindern, die nicht so gut sangen. Das gefiel mir natürlich nicht, weil ich immer dort sein wollte, wo die Guten waren. Aber sie ließ mich auch spüren, dass ich eine Verantwortung habe. Ich war vielleicht gerade mal fünf, sechs Jahre alt und spürte die Verantwortung, dass ich dazu beitragen müsste, dass alles gelingt.

An einer Stelle in Ihrer Rede erzählen Sie von Ihrer Enttäuschung, als Ihre Lehrerin Ihnen nicht das Solo gibt, weil sie meint, in dem Stück seien ja genug Hannigans vertreten.
Hannigan: Ich habe es natürlich meinen Geschwistern, die auch mitgesungen haben, gegönnt, aber ich war sehr frustriert, sehr enttäuscht. Gar nicht unbedingt aus Neid, sondern aus dem Gefühl heraus, nicht richtig gesehen zu werden.
Aber Sie blieben bei der Musik.
Hannigan: Ja, in solchen Momenten der Frustration erkennt man, ob man das Zeug hat für eine solche Karriere oder nicht. Man kann ja nicht ständig Lob erwarten. Es war eine temporäre Frustration, die mich aber niemals gestoppt hätte.
Wie gehen Sie in ähnlichen Situationen heute mit Ihren Studenten um?
Hannigan: Ich bin sehr direkt. Konstruktive Kritik ist sehr wichtig; sie ist das Einzige, was den Leuten helfen kann. Ich bin auch recht offen im Eingestehen meiner eigenen Kämpfe und Zweifel. Meine Schüler merken dies.
Daniel Barenboim wird derzeit wegen seines Führungsstils kritisiert. Wie nett darf man in der Kunst sein?
Hannigan: Mit Daniel Barenboim habe ich noch nie zusammengearbeitet, aber um Ihre Frage zu beantworten: Als „CEO“ ist man für alles verantwortlich. Wie ich vorhin sagte: Beim Musizieren funktioniert vieles, aber beim Planen unserer Projekte bin ich oft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich gehe ständig Risiken ein. Da muss man den Menschen vertrauen können, dass auch sie das Beste geben.
Ihr jüngstes Projekt in Hamburg ist eine halbinszenierte Aufführung von Strawinskys „The Rake’s Progress“.
Hannigan: Ein Meisterwerk! Es war die erste Oper, in der ich als Sängerin mitwirkte, die Partie der Anne Trulove habe ich seitdem mehrfach gesungen. „The Rake’s Progress“ ist eine zeitlose, wahre und wahrhaftige Geschichte über einen jungen Mann, der die Liebe und die Sicherheit aufgibt, um sein Leben zu verspielen.
Die Geschichte des Lebemanns Tom Rakewell, der sein Geld verzockt, Affären mit Frauen hat, sich und andere ruiniert und schließlich in der Psychiatrie landet.
Hannigan: Ja, er schließt einen Pakt mit dem Teufel. Und kann ihn nur verlieren. Für das Orchester ist alles ein reiner Spaß, da Strawinsky das Werk im neoklassizistischen Stil komponierte, nach dem Vorbild Mozarts, den er aber dann wieder verfremdet. Die Inszenierung findet sozusagen unter ständiger Beobachtung statt, nicht nur seitens des Publikums. Nach ihrem jeweiligen Auftritt stellen sich die Künstler an die Seite der Bühne und beobachten das weitere Geschehen. Und: The devil is watching you, auch wenn er keine Figur auf der Bühne darstellt.
Barbara Hannigan singt und dirigiert aus „The Rake’s Progress“: