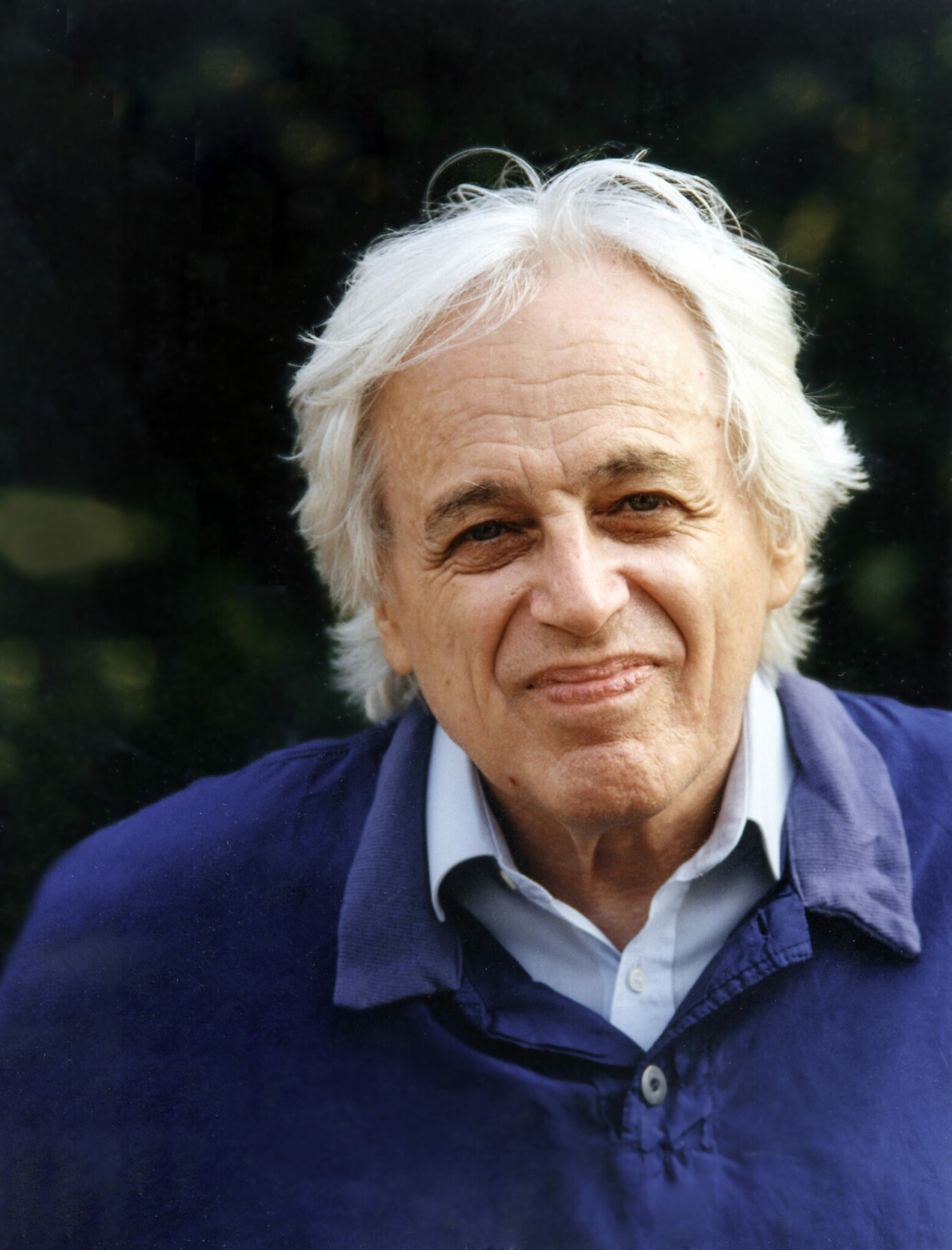Herr Schultz, Ihre Oper „Achill unter den Mädchen“ wird bereits zum zweiten Mal inszeniert. Viele neuere Werke kommen über eine Uraufführung gar nicht hinaus …
Wolfgang-Andreas Schultz: … und das hat selten etwas mit Qualität oder Erfolg zu tun. Meine beiden Opern „Sturmnacht“ 1987 in Nürnberg und „Achill unter den Mädchen“ 1997 in Kassel waren eindeutige Publikumserfolge. Auch wenn die Presse gespalten war. Die „Sturmnacht“ wurde einerseits als zukünftiges Repertoirestück gefeiert. Andererseits gab es heftige Verrisse mit dem Hinweis, das sei ja keine moderne Musik. Folge-Inszenierungen gab es zunächst keine. Obwohl mein „Achill“ ja ein Genre wiederbelebt, welches viele Menschen in der modernen Musik vermissen: die Buffo-Oper.
Das Libretto von Hanns-Josef Ortheil fokussiert sich nicht auf Achill als Helden im Trojanischen Krieg, sondern auf die weniger bekannte Vorgeschichte …
Schultz: Wir erzählen die Geschichte des jungen Achill, dem das Orakel voraussagt, er würde im Krieg fallen, und der deshalb auf der Insel Skyros als Mädchen verkleidet versteckt wurde. Dort verliebt er sich in Deidamia, die älteste Tochter des Königs. Ihr gegenüber muss er seine Männerrolle finden, während er Fremden gegenüber ein Mädchen spielt. Ich bin ein großer Händel-Verehrer und habe diesen Stoff durch seine Oper „Daidamia“ kennengelernt. Anders als in dieser Oper durchläuft Achill bei mir eine Art Initiation durch ein Spiel im Spiel. Dafür habe ich die Geschichte mit einem anderen Händel-Stoff kombiniert, mit „Acis und Galatea“.

Sie ordnen den Figuren musikalische Elemente aus verschiedenen Kulturen zu. Wie sind Sie darauf genommen?
Schultz: Durch Peter Brooks Inszenierung von Shakespeares „Der Sturm“, die ich in Hamburg auf Kampnagel sehen konnte. Er hat die Figuren mit Schauspielern aus verschiedenen Kulturen besetzt und damit schon die Rollen interpretiert. Der Luftgeist Ariel ist Afrikaner, Miranda eine Inderin. Brooks Idee war, dass alle Kulturen sich einseitig entwickelt haben und dass das Theater der Ort sein könnte, an dem sich diese Einseitigkeiten ergänzen und wieder zusammengeführt werden. Diesen Gedanken wollte ich auf die Musik übertragen.
König Lycomedes wird also nicht in strahlende Fanfaren gehüllt?
Schultz: Ein König mit Pauken, Trompeten und punktierten Rhythmen – das geht gar nicht, weil es entsetzlich konventionell ist. Ihn dagegen mit zeremoniellen Gagaku-Klängen aus dem japanischen Kulturkreis zu begleiten, unterstreicht seine distanzierte Würde, ja Weltfremdheit. Daidamia, die immer das Verbindende sucht, lässt indische Ragas anklingen. Und der Möchtegern-Macho Phönix singt Rock ’n’ Roll, Rap und lateinamerikanisch beeinflussten Pop. Die verschiedenen Lebensentwürfe, die sich mit diesen Musikkulturen verbinden, werden zur Charakterisierung der Figuren eingesetzt. Dadurch sind die Rollen musikalisch sehr stark individualisiert.
Wie groß war die Herausforderung, diese unterschiedlichen Klangwelten in Ihren eigenen Stil zu integrieren?
Schultz: Dazu gibt es ein schönes philosophisches Bild: Indras Netz. Es kommt aus dem Indischen, wird aber auch im Buddhismus oft verwendet. Das Bewusstsein wird hier als ein Netz von Perlen vorgestellt, die alle ihre Individualität haben und trotzdem alle anderen in sich spiegeln. Das ist eine schöne Idee, wie man mit anderen Kulturen umgehen kann. Man hat seine eigene Identität, seine eigene Musik und spiegelt darin die anderen Kulturen. Dabei geht es mir auch um die entsprechenden Philosophien und Lebenshaltungen, mit denen ich zum Beispiel durch den Zen-Buddhismus und Yoga in Berührung gekommen bin.
„Achill unter den Mädchen“ stammt dem Jahr 1995. Warum haben Sie danach nie wieder ein Bühnenwerk geschrieben?
Schultz: Die Oper war ein Auftragswerk der Schwetzinger Festspiele, fiel dort aber dem Wechsel in der Direktion zum Opfer – dem Neuen passte das Werk nicht in seine Vorstellung von Moderne. Dann holte ein Regisseur, der mich kannte, das Werk nach Kassel. Aber Kassel wurde zum Alptraum. Zuerst geriet „Achill“ in den Streit zwischen Regisseur und GMD. Schließlich wurde das Stück doch geplant, aber wegen der personalintensiven Produktion vorher waren keine Sänger für mein Stück frei, und es fehlte an Geld für Gäste. Schließlich zerstritten sich Regisseur und Intendant und kommunizierten nur noch über ihre Anwälte. Der Regisseur hatte bis zuletzt Angst, der Intendant könnte die Produktion kippen. Und das ist noch längst nicht alles …. Dass unter diesen Umständen doch noch eine ganz anständige Aufführung zustande kam, grenzt an ein Wunder. Trotzdem habe ich mir geschworen, nie wieder etwas fürs Theater zu schreiben, wobei ich mich natürlich freue, wenn ein fertiges Stück erneut aufgeführt wird.
Sie haben bei György Ligeti Komposition studiert, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Später waren Sie sein Assistent an der Hamburger Musikhochschule. Welche waren die entscheidenden Impulse, die Ligeti Ihnen als Mensch und Künstler mitgegeben hat?
Schultz: Spannend war die große Offenheit, die in seiner Klasse herrschte. Es ging nicht nur um Avantgarde-Musik, sondern auch um Musik anderer Kulturen, Pop und Jazz. Das war unglaublich anregend. Ich merkte aber bald, dass Ligeti und ich auf unterschiedlichen Dampfern fuhren, was die Lebenshaltung und Ästhetik betraf. Dass ich mich schon früh wieder der Tonalität zugewandt habe, empfand er als zu altmodisch. Das handwerkliche Können hat er aber immer anerkannt.
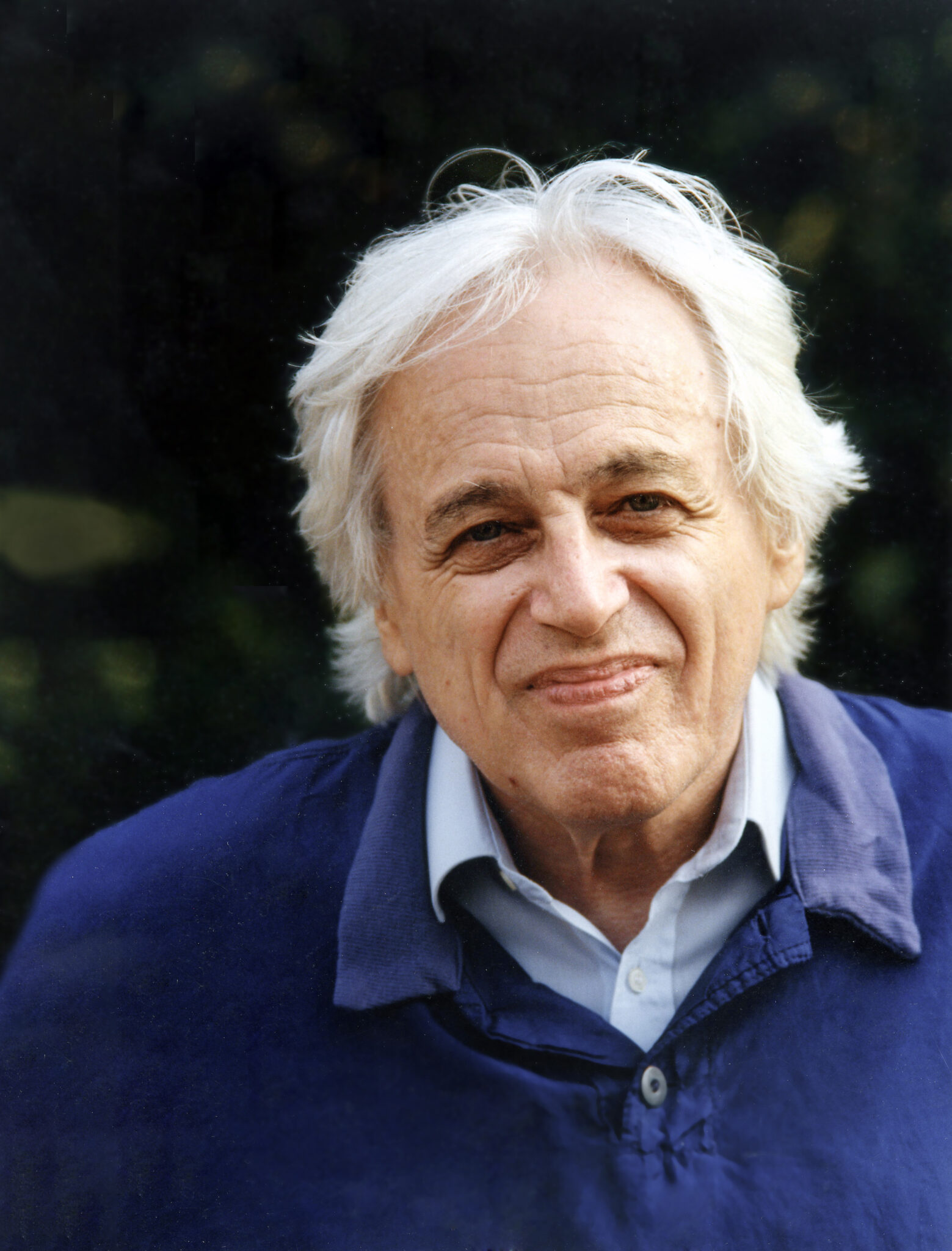
Verlangte Ligeti Neuerungen um jeden Preis?
Schultz: Wenn er sagte „Das klingt nach moderner Musik“, bedeutete das: Daumen runter, weil er damit die ganzen Floskeln meinte, die man auf Musikfesten schon zur Genüge gehört hatte. Er verlangte sehr viel Originalität und vergaß dabei, dass er selbst erst durch Nachahmung von Bartók und Strawinsky seinen eigenen Stil gefunden hatte. Für sehr junge Studierende war das ein Problem. Andererseits hat seine kritische Haltung zur Neuen Musik uns sehr ermutigt, uns abzuseilen von avantgardistischen Strömungen. Vieles, was dann Anfang der 1980er-Jahren unter dem Begriff der „Neuen Einfachheit“ gefasst wurde, kam aus der Ligeti-Klasse.
Wie sah es in dieser Zeit mit Kompositionsaufträgen aus?
Schultz: Aufträge für einschlägige Festivals wie die Wittener Tage für neue Kammermusik oder die Donaueschinger Musiktage gab es nur, wenn man im Stil der Avantgarde komponierte. Insofern war es ein Glücksfall, dass Ligeti mir einen Lehrauftrag als sein Assistent für Kontrapunkt und die musiktheoretischen Fächer verschaffte. So war ich nicht darauf angewiesen, mich anpassen zu müssen, um mit dem Komponieren Geld zu verdienen, war damit im Grunde genommen aber auch herausgemobbt aus der Szene der Neuen Musik.
Im letzten Jahr ist Ihr Buch „Europas zweite Renaissance“ erschienen. Darin führen Sie die Krisen der Moderne auf die in der ersten Renaissance erfolgte Trennung des Menschen von der Natur, die Trennung Gottes von seiner Schöpfung und die des Ichs vom Anderen zurück. Ist die „zweite Renaissance“, von der Sie sprechen, eine Bestandsaufnahme oder ein Plädoyer?
Schultz: Ein Plädoyer, wobei ich den Eindruck habe, dass schon sehr viel in Bewegung geraten ist. Aktuell erleben wir, dass Begriffe wie Schönheit und Harmonie wieder eine größere Rolle spielen. Man interessiert sich für indigene Kulturen und denkt ganz anders über die Natur nach. Das ökologische Bewusstsein hat Auswirkungen auf die Ästhetik und die Künste. Viele glauben immer noch, ein Komponist muss Neues auf der materiell-klanglichen Ebene erfinden. Dabei kann man auch mit vorhandenem Material Neues Schaffen, indem man es neu verknüpft. Ahnherr für eine solche Entwicklung in neuerer Zeit ist Debussy. Er hat sich auch für Gregorianik, französische Barockmusik und Gamelan interessiert und diese Einflüsse in seine Stücke eingearbeitet. Man muss nicht über die freie Atonalität und Zwölftontechnik zu Webern, Stockhausen und Lachenmann gehen, sondern kann von Debussy aus zu einer polyfonen Erzählung der Musikgeschichte finden, in der auch Strömungen ihren Platz finden, die mehr an Verbindungen zur Tradition und an Integration interessiert sind.