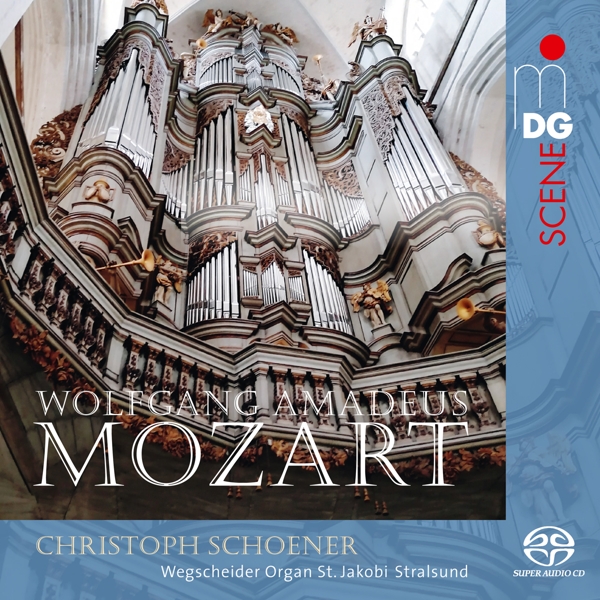An Silvester gibt Christoph Schoener sein Abschiedskonzert, womit am Michel eine Ära zu Ende geht. In Schoeners Büro indes weist noch nichts auf seinen bevorstehenden Abschied hin – bis auf eine Postkarte, die an seiner Tür klebt. Darauf steht geschrieben: „… wenn ich alt bin, werde ich nur nörgeln. DAS WIRD EIN SPASS!“ Keine Frage: Der Mann hat Humor und Sinn für Selbstironie.
Herr Schoener, machen Sie nun endgültig Schluss mit Ihrem Beruf oder werden Sie noch hie und da Orgelkonzerte geben?
Christoph Schoener: Natürlich gebe ich noch Konzerte! Es ist ein Riesenglück, dass ich nicht auf das Dirigieren spezialisiert bin. Vor meiner Hamburger Zeit habe ich mir meinen Namen auch eigentlich als Organist gemacht.
Über wie viele Konzerte sprechen wir da?
Schoener: Im kommenden Jahr sind nach dem jetzigen Stand dreißig Konzerte geplant.
Also gehen Sie jetzt erst einmal in den Unruhestand.
Schoener: Ich spiele einfach zu gerne Orgel! Aber vielleicht wird das mal eines Tages weniger, wer weiß.
Und Ihre Lehrtätigkeit?
Schoener: Die ist vorbei. In Leipzig hatte ich vier Semester lang eine Lehrstuhlvertretung. Auch da habe ich schon gemerkt, dass die jüngeren Professoren eher Coaches oder Berater sind. Da bin ich mit meinen 66 Jahren schon old school, also eher der Typ Lehrer, der den Schülern sagt: „In der nächsten Woche möchte ich bitte das Bach-Präludium unfallfrei hören, falsche Töne spielen Sie in Ihrem Leben noch genug.“ Aber das Unterrichten war immer eine große Leidenschaft von mir. Ich habe mal gezählt und bin auf 44 Semester an Hochschulen per Lehrauftrag gekommen.
Welche Hochschule hat Sie besonders begeistert?
Schoener: Leipzig fand ich schon toll, auch, weil es so ein magischer Ort ist. Düsseldorf wurde, finde ich, in der Wahrnehmung der fachlichen Öffentlichkeit immer unterschätzt. Vierzehn Jahre habe ich dort gelehrt, das war für mich sicher die wichtigste Zeit.
Trotzdem haben Sie 1998 als verdienter Landeskirchenmusikdirektor im Rheinland Ihre Stelle aufgegeben für ein neues Abenteuer in Hamburg. Warum?
Schoener: Eine berechtigte Frage: Ich hatte damals gerade ein Haus gebaut, hatte drei Kinder … Dann kam der Anruf aus Hamburg mit der launigen Bemerkung, meine Bewerbung würde noch fehlen. Ich habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt, habe aber gleichzeitig erwidert, dass aus der Stellenausschreibung hervorgeht, dass sie am Michel eigentlich einen Kapellmeister brauchen. Aber ich war ein Kirchenmusiker, der eben nicht nur dirigiert, sondern auch mindestens genauso leidenschaftlich gerne Orgel spielt. Aber meine Frau hat damals gemeint, ich sollte nicht den Rest meines Lebens mit dem Gefühl zubringen, eine fantastische Chance verpasst zu haben, und dann habe ich mich eben doch beworben. So richtig geglaubt habe ich nicht an einen Erfolg, aber die Findungskommission hat mich dann doch gewählt.
Was folgte, war ein denkbar schwieriger Einstand für Sie: Der damalige Chor strafte Sie mit kalter Ablehnung ab, nicht zuletzt deshalb, weil Sie das Konzertprogramm des Chores erweitern wollten beziehungsweise weil Sie schlicht Dinge anders machen wollten als Ihr Vorgänger. Sahen Sie sich zu dieser Zeit als Einzelkämpfer?
Schoener: Ja! Es kam zu einer Neugründung des Chores, was auch damit zu tun hatte, dass Martin Behrmann mit seiner Cappella Vocale aufgehört hat und einige der damaligen Mitglieder sich plötzlich in meinem Chor wiedergefunden haben – ich möchte fast sagen: aus Solidarität zu mir. Es kamen dann also mindestens zwanzig A-cappella-trainierte Chorsänger, ein Riesenglück! Einige von Ihnen sangen bis zuletzt in meinem Chor.
Wie kamen Sie damals als gebürtiger Heidelberger, der vierzehn Jahre lang im Rheinland gelebt hat, mit der Hamburger Art zurecht?
Schoener: Ich finde, dass die Hamburger entgegen allen Gerüchten einen guten Humor haben! Der ist halt ein bisschen trockener und etwas knapper. Klar, in meiner Zeit im Rheinland war ich in einer Umgebung, in der jeder jeden liebhatte. Aber wenn man immer so liebgehabt wird, verliert das etwas die Glaubwürdigkeit.

Sie sind in Heidelberg und Mannheim aufgewachsen, haben in Freiburg studiert und lange Zeit in Leverkusen gelebt, ehe Sie 44-jährig nach Hamburg gezogen sind, wo nun Ihre Zeit als Kirchenmusikdirektor von St. Michaelis endet. Was ist ihre nächste Station?
Schoener: Ich habe hier mein Haus, ich werde jetzt hier auch alt – und verwirkliche meinen Traum, freischaffender Konzertorganist zu sein! Das ist ja das Schöne an der Lebensphase, die jetzt für mich beginnt: Ich kann, muss aber nicht.
Wie meinen Sie das?
Schoener: Als junger Mann wollte ich unbedingt freier Konzertorganist sein. Aber wenn Sie dann, wie es mir tatsächlich passiert ist, in Norrköping vor siebzehn Besuchern spielen, danach nur ein tristes Hotelzimmer und geschlossene Kneipen vorfinden und am nächsten Tag wieder 600 Kilometer für das nächste schlechtbezahlte Konzert zurücklegen müssen, dann relativiert sich dieser Traum plötzlich.
Wie lange haben Sie versucht, Konzertorganist zu sein?
Schoener: Naja, so realistisch war ich schon, dass ich als junger Musiker wusste, dass das nicht so einfach läuft. Bis heute beruht bei Organisten das Konzertieren nach dem Prinzip von Einladung und Gegeneinladung. Ohne eigene Orgel, also ohne eine Kirchengemeinde im Rücken kommt man da nicht weit. Klar, es gibt die Organisten, die Preise gewinnen und dann von Konzertsaal zu Konzertsaal reisen können. Aber das sind nur sehr, sehr wenige Glückliche.
Wie hat sich denn der Beruf des Kirchenmusikers im Laufe Ihrer Karriere verändert?
Schoener: Da muss ich bei der Generation meiner Lehrer anfangen, die in den Fünfziger-, Sechzigerjahren ihre Kunst zum festen Berufsstand erheben konnten, ein großes Verdienst! Die Landesverbände der Kirchenmusiker wurden gegründet, Besoldungsgruppen eingeführt. Die Reformen gingen so weit, dass heute in den Präambeln der meisten Landeskirchen steht, dass Kirchenmusik die Verkündigung des Wort Gottes mit den Mitteln der Musik ist.
Und dann?
Schoener: Dann kamen irgendwann die Sparzwänge. Das habe ich insbesondere als Landeskirchenmusikdirektor im Rheinland erlebt, als ich mit dem Taschenrechner durch die Landeskirche gefahren bin und Teilzeitstellen ausgerechnet habe. Das war für mich sehr unbefriedigend, denn an diesem Punkt ging die Schere auseinander: Wir haben die Stars in den ganz großen Kirchen der Republik, die in Sachen Kirchenmusik so bestehen bleiben, und den Rest bestreiten dann die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker auf den kleineren A- und B-Stellen, an denen aber am ehesten gespart wird. Und an den nebenamtlichen Kirchenmusikern, die für die Kirche von unschätzbarem Wert sind, wird am ehesten gespart!
Also haben Sie ein eher pessimistisches Bild der Lage?
Schoener: In dieser Hinsicht ist das so, ja. Aber wenn wir damit rechnen, dass wir im Jahr 2060 nochmal vierzig Prozent weniger Kirchenmitglieder haben, dann müssen wir logischerweise auch damit rechnen, dass es vierzig Prozent weniger Kirchenmusiker geben wird. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Hochbegabungen unter den jugendlichen Organisten so signifikant gestiegen sind wie bei den Pianisten auch. Mein Gott, was machen die dann alle? Damit einhergehend ist natürlich eine säkularere Öffentlichkeit bzw. ein säkulareres Publikum nicht schlecht.
Also steht uns eine Ära der Konzertsaal-Organisten bevor?
Schoener: Ja und nein. Selbst so ein Hype um die Orgel in der Elbphilharmonie ist ja nicht unnütz. Und jetzt erleben wir beim „Hamburger Orgelsommer“ Publikumszuwächse von zehn bis zwanzig Prozent! Insofern glaube ich schon noch an die Zukunft der Orgelmusik, und ich glaube auch an die Zukunft der Kirchenmusik. Bach wird immer aufgeführt werden.
Auch in der Kirche?
Schoener: Ja! Das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität ist ja geblieben, wenn nicht sogar gewachsen. Ich erlebe das an manchem Karfreitag: Wenn ich die „Johannes-Passion“ mache, dann ist die Kirche voll! Und dann gibt es Veranstaltungen wie das Reeperbahnfestival, bei dem Leute in die Kirche kommen, die sonst womöglich nie eine Kirche betreten würden, und hören ein Konzert – natürlich kein klassisches Kirchenkonzert –, und trotzdem herrscht da eine ganz spirituelle Stimmung. Ja, ich bin von der Zukunft der Musik in der Kirche und der traditionellen Kirchenmusik absolut überzeugt.