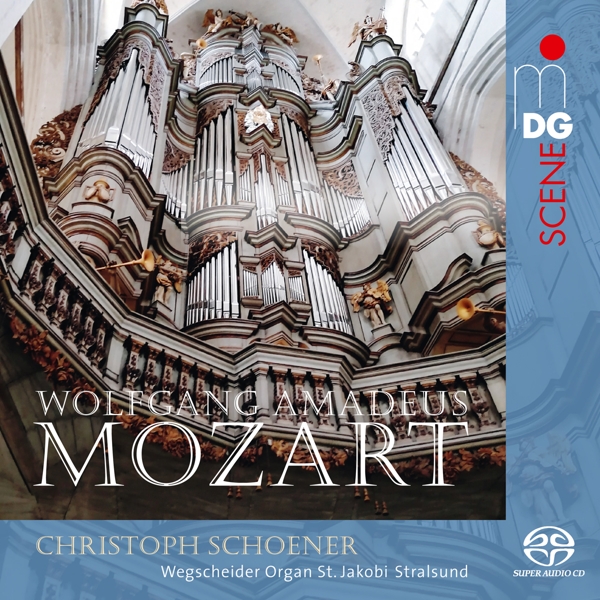Christoph Schoener wurde in Heidelberg geboren, hat in Freiburg, Paris und Amsterdam studiert, war Landeskirchenmusikdirektor im Rheinland und ist seit 1998 als Kirchenmusikdirektor am Michel tätig. Dort leitet er Aufführungen großer Oratorien, spielt aber auch die Orgel im Gottesdienst und zu Konzerten. Er kommentiert bereits während des Hörens.
 Buxtehude: Praeludium in g, BuxWV 149
Buxtehude: Praeludium in g, BuxWV 149
Ton Koopman (Schnitger-Orgel in St. Jacobi Hamburg) 2007
Challange Classics
Das ist Ton Koopman mit Buxtehude. Ich höre das ausgesprochen gern. Aber ich finde, man spürt, dass er von der Musik getrieben ist, manchmal auf Kosten der Balancen. Es ist stilistisch perfekt, aber wie alles bei Koopman etwas zu schnell. Ich habe immer das Gefühl, danach brauche ich erst einmal Ruhe. Das elfte Gebot: Du sollst nicht langweilen, erfüllt Koopman immer, sein Spiel ist immer anregend… Historische Aufführungspraxis auf der Orgel heißt zunächst: gut artikuliertes Spiel, dass die Akzente richtig gesetzt werden, dass das Legato, das ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, in der Barockmusik keine Rolle spielt – dass man aber dennoch der Forderung nach Kantabilität nachkommt… Koopman spielt das schon sehr schön. Ich finde allerdings, dass er generell zu viel trillert: Wenn er einen Finger freihat, wird getrillert. Verzierungen sollten aus einer Notwendigkeit heraus gemacht werden – man will einen Akzent zeigen oder eine Kadenz abschließen… Das ist eine schöne Orgel, eine Schnitger-Orgel. St. Jacobi? Das ist eine der wenigen Orgeln von Weltrang… Es ist völlig falsch, Buxtehude als Vorläufer von Bach aufzufassen. Das ist so eine aufregende Musik, besonders seine Orgelmusik ist voller Dramatik, wenn man sie darstellen kann – und das kann Ton Koopman. Ich bin 2007 zu einem Buxtehude-Abend in der Kathedrale von Barcelona eingeladen worden, das fand ich fast skurril. Ich habe versucht, ein Programm zusammenzustellen, das genug Abwechslung bietet. Und das geht. Man unterschätzt Buxtehude.
 Bach: Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98
Bach: Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98
Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner (Leitung) 1998
DG Archiv
Das ist ein Orchesterklang, den ich liebe. Frei von Übertreibungen, es fließt. Ich schwanke zwischen Herreweghe, Koopman und Gardiner, aber ich vermute, es ist Gardiner mit dem Monteverdi Choir. Dann ist es eine Bach-Kantate, die ich noch nie aufgeführt habe. Ich schätze den Klang des Monteverdi Choir, weil es bei aller Strenge in der Stimmgebung, bei aller Klarheit eine Wärme hat. Man unterstellt Gardiner oft eine gewisse Kühle – ich kann das überhaupt nicht finden. Ich bin auch erfreut, dass da nicht vier Leute stehen und singen, sondern dass man einen Bach-Klang hat, der einen packt und genauso klar ist wie bei den modernen Versuchen mit solistischer Besetzung. Da bin ich zu sehr Kirchenmusiker – ich weiß, dass wir sowieso alles falsch machen müssen, ich darf nur nicht vorsätzlich stilistische Fehler machen. Wenn ich eine h-Moll-Messe aufführe, weiß ich, dass Kyrie und Gloria eigentlich mit fünf Sängern aufzuführen wären. Aber ich muss an der Stelle, an der ich arbeiten darf, einfach mit den Gegebenheiten umgehen. Die Spekulation, ob Bach einen Chor mit 60 Leuten gemocht hätte, ist müßig – wir wissen auch nicht, ob er den Steinway-Flügel geliebt hätte. Wenn ich im Chor arbeite, bin ich in vielen Dingen sehr genau: Bei der Frage zum Beispiel, wann hört ein Ton auf und wie. Ich finde es fantastisch, wenn bei einem Bach-Choral alle Konsonanten wirklich übereinander sind. Beim Orgelspiel finde ich das vokale Denken wichtig: Wo müsste ein Sänger atmen, wo geht eine Phrase hin. Das befruchtet sich gegenseitig, das Problem ist nur, dass der Tag zu kurz ist. Manchmal denke ich, wenn ich einen Profichor hätte, dann müsste ich manches nur einmal sagen, die tragen das in ihre Noten ein, und ich kann damit rechnen, dass es eine Woche später auch kommt. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass am Michel sehr gute Leute singen. Wenn man einen sogenannten Laienchor so führen kann, dass im Konzert alle über sich selber hinauswachsen, das ist schon etwas ganz Besonderes.
 C.P.E. Bach: Konzert für Orgel, Streicher und b.c. G-Dur H 444
C.P.E. Bach: Konzert für Orgel, Streicher und b.c. G-Dur H 444
Roland Münch (Amalienorgel in Berlin-Karlhorst), Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, Hartmut Haenchen (Leitung) 1985
Capriccio
Das ist C.P.E. Bach, aber das Stück kenne ich nicht. Es sind kenntnisreich spielende moderne Instrumente. Hartmut Haenchen? (die Orgel setzt ein) Das ist das G-Dur-Konzert, das habe ich nie gespielt. Ich weiß, es gibt eine Aufnahme mit dem früh verstorbenen Roland Münch an der tollen Migend-Orgel in Berlin-Karlshorst. Haenchen macht das heute sicherlich anders, da wird schon noch viel vibriert im Orchester. Aber das waren Pioniere damals, ich habe hohen Respekt vor diesem Spiel. C.P.E. Bach zu spielen ist richtig schwer fürs Orchester, für den Chor ist es übersichtlich. Die Musik ist sehr affektgeladen, sehr ausdrucksstark, und ich finde, als Kantor am Michel hat man auch die Pflicht, sie gelegentlich aufzuführen.
 Reubke: Orgel-Sonate c-Moll „Der 94. Psalm“
Reubke: Orgel-Sonate c-Moll „Der 94. Psalm“
Michael Schönheit (Ladegast-Orgel im Merseburger Dom) 2005
MDG
Dieses Stück ist wie für mich komponiert. (lacht) Das ist eines der genialsten Stücke des 19. Jahrhunderts. Reubke war 23, als er das geschrieben hat – ein Jahr später ist er gestorben. Wer weiß, was da noch gekommen wäre. Ist das in Leipzig aufgenommen? Oder in Merseburg? Man ist bei seinem eigenen Repertoire natürlich befangen. Das Stück ist so konfliktträchtig, man muss auch im lyrischen Teil hören, dass sich schon der Tsunami zusammenbraut. Aber hier brodelt es nicht, es könnte spannungsreicher sein… Jetzt spielt er über die Wagnerschen Harmoniewechsel einfach hinweg… Es ist sehr gut angelegt, das Tempo ist sympathisch, es wird oft zu schnell gespielt. Lassen Sie uns mal ins Adagio reinhören… Da würden die Leute im Konzert anfangen zu husten. Es fehlt mir ein bisschen die Richtung. Aber es klingt toll auf dieser Orgel. (Fuge) Genau dasselbe. Das ist eine gute Aufnahme, aber kein ganz großer Wurf. Ist der Organist Michael Schönheit?
 Mendelssohn: Herr, sei gnädig
Mendelssohn: Herr, sei gnädig
Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius (Leitung) 2005
Carus
Ist das ein Chor aus Stuttgart? Bernius mit Mendelssohn. Das ist eine der wenigen Motetten, die ich nicht aufgeführt habe. Das ist offiziell kein Profi-Chor, aber doch ein Chor, in dem alle eine Gesangsausbildung haben. Man kann das nicht damit vergleichen, wenn ich jeden Donnerstag kenntnisreiche und gutwillige Menschen um mich habe. Er hat andere Möglichkeiten, aber auch andere Grenzen. Die singen so, wie ich‘s gern mit meinem Chor täte. Und gleichzeitig hat es eine gewisse Kühle – vielleicht bin ich auch nur neidisch. Wenn jemand Mendelssohns Kirchenmusikwerke kennenlernen will, würde ich sagen: Kauf dir die Aufnahmen vom Stuttgarter Kammerchor, das ist wahnsinnig gut. Aber wenn man die dritte CD gehört hat, gibt es keine großen Überraschungen mehr – und das liegt nicht an Mendelssohn. Es gibt keinen wahrhaftigeren Textausdeuter und Dramatiker. Natürlich gibt es manches Biedermeierliche, aber auf Mendelssohn lasse ich nichts kommen. Ich finde es furchtbar, wenn Leute Perfektion als Makel darstellen. Perfektion ist für mich schon ein Ziel. Aber sie ist nicht alles. Sagen wir mal so: Das Klangbild, das ich mit meinem Chor erreichen kann, hat auch seine Berechtigung.
 Brahms: Ein deutsches Requiem. Wie lieblich sind deine Wohnungen
Brahms: Ein deutsches Requiem. Wie lieblich sind deine Wohnungen
Rundfunkchor Berlin, Berliner Philharmoniker, Simon Rattle (Leitung) 2006
EMI
Das ist das Tempo, das Brahms fordert, es gibt ja Metronom-Zahlen von Brahms, die sind nur nicht gedruckt. Die erste und die letzte Nummer haben Leute wie Karajan und Klemperer viel zu langsam genommen. Und dieses vierte Stück wird oft zu schnell gemacht. Es ist ein vergleichsweise kleiner Chor, rund 60 Sänger würde ich sagen. Das ist die „informierte Art“ zu spielen, dabei kann ich mir Brahms auch mit alten Instrumenten vorstellen. Das Orchester und der Chor sind blitzsauber, die können verdammt gut singen. Ein Rundfunkchor? Aber ich bin nicht wirklich überzeugt. Was mich am meisten stört, ist vielleicht die Aufnahmetechnik. Ich schätze ja den schlanken Klang, aber das hier ist mir zu trocken, zu direkt, es fehlt die Mitte. Das ist alles gut, aber es erreicht mich nicht, es bleibt ein Hauch von Unzufriedenheit. Die Stärke des Brahms-Requiems ist die religiöse Weite, das ist sicher das ökumenischste, humanistischste kirchenmusikalische Werk, bei dem sich viele Leute finden, die eigentlich religiös distanziert sind. Ich halte es für einen ganz groben Schnitzer, das Stück am Karfreitag aufzuführen. Denn dessen Kern, der christologische Aspekt, fehlt ja im Stück. Da bin ich liturgisch streng. Aber ich finde, man kann es gut im Konzertsaal aufführen. Obwohl es natürlich nirgends so schön klingt wie bei uns im Michel, jedes Jahr vor dem Totensonntag