Man kennt Daniel Stabrawa als Ersten Konzertmeister der Philharmoniker. Doch der 55-jährige gebürtige Krakauer ist noch viel mehr: Mitbegründer und Primarius des Philharmonia Quartetts, Dirigent, Solist – und ein meinungsfreudiger CD-Hörer.
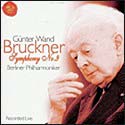
Bruckner: Sinfonie Nr. 9, 2. Satz
Berliner Philharmoniker,
Günter Wand (Leitung) 1998
RCA Red Seal
Das ist mit Kraft gespielt. Wenn wir das wären, wäre ich zufrieden. Das ist in unsere Richtung, mit viel Engagement von allen… Das hier ist eine Stelle, wo kaum einer Accelerando macht, obwohl es sein müsste, weil es technisch so schwer ist. Vom Klang her könnten wir das sein. Auf jeden Fall ein gutes Orchester. Und ein Dirigent, der die Musiker zwingt. Auch wenn wir Musiker den Dirigenten nicht mögen, weil er uns Befehle erteilt und keinen Widerspruch leidet – es ist der Dirigent, der uns die Vision gibt und das ganze steuert. Obwohl wir uns im Probespiel Kollegen suchen, die ungefähr gleich denken, hat jeder seine eigene Persönlichkeit, und wenn wir keine Führung haben, zieht jeder in eine andere Richtung. Das allerschwierigste ist solch ein Stück, das wir oft gespielt haben. Man hat im Orchester nicht den Überblick über den Klang, man muss sich auf den Dirigenten verlassen… Das hier ist eine verdammt schwere Stelle, große Leistung. (Trio) Da hätte ich mir ein bisschen mehr Grazie gewünscht, es ist sehr präzise gespielt, aber sehr stur. Aber das hier ist sehr schön. … Wahnsinnig sauber, präzise, ich glaube, das sind doch nicht wir. (lacht) Ein toller Dirigent, der es klanglich sehr schön gestaltet, viele Farben, breit, sehr präzise. Ist das im Studio oder live aufgenommen? Live? Großer Respekt! Das sind wir? Mit Barenboim? Hm, wir haben das mit Günter Wand gespielt. Wäre möglich. Unglaublich präzise, da staune ich. So wünsche ich mir, die Musik zu hören.
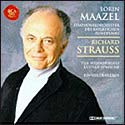
Strauss: Ein Heldenleben. 3. Satz (Geigensolo)
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Lorin Maazel (Leitung)
ohne Angabe des Konzertmeisters 1996
RCA Red Seal
Das bin nicht ich, da bin ich sicher. Aber sehr schön gespielt. Das habe ich so oft gespielt, mit Karajan, mit Mehta, das hat mein Leben geprägt, da bin ich sehr kritisch. Diese Stelle hier hat mir nicht gefallen, das war ohne nachzudenken, was es soll. Aber er hat einen schönen Klang. Dieses Solo macht Spaß, man kann sich ausspielen, ist absolut frei, aber man muss sich viele Gedanken machen und unglaublich farbig spielen, sonst ist die Musik nichtssagend. Mir ist das ein bisschen zu wenig intim. Da war ein komischer Triller. Ist das ein älterer Herr? Bayerischer Rundfunk? Das würde passen… Hier muss der Dirigent nach vorn gehen, es muss explodieren – aber da geschieht nichts, das klingt wie Mozarts Nachtmusik. … Na, diese Stelle spielt er nur auf Sicherheit. Manchmal ist es wichtiger, dass der Ausdruck stimmt, als dass alle Noten richtig gespielt werden. Aber es ist ein guter Geiger, er macht schöne Sachen. Bei diesem Stück ist es kein Problem, herauszutreten aus dem Tutti, hier kann man zaubern. Für Solisten ist das schwieriger. Wenn man 40 Minuten lang wahnsinnig schwere Sachen zu spielen hat, muss man sich konzentrieren, dass alles stimmt. Aber Solisten haben es auch wieder einfacher. Sie üben ihre Stimme ein, und dann heißt es: Augen zu und durch. Oft höre ich phänomenale Solisten, die spielen drei Auftritte absolut gleich, da denke ich mir: Haben die überhaupt Spaß am Musizieren? Die großen Musiker sind die, die jedes Mal etwas anders spielen, entsprechend der Stimmung und wie die Musik sich entwickelt. Das ist die große Kunst, auf die Situation, aufs Publikum zu reagieren. Das ist Musik für mich.
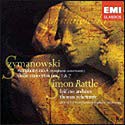
Szymanowski: Violinkonzert Nr. 1
Thomas Zehetmair (Violine)
City of Birmingham Symphony Orchestra
Simon Rattle (Leitung) 1995
EMI Classics
Das ist ein tolles Konzert! Da spielt jemand mit unglaublicher Wehmut und Kraft, das gefällt mir. Sehr schön! Vielleicht ein bisschen zu exaltiert am Anfang, aber er will was draus machen. Das ist mit unglaublicher Intensität gespielt. Frank Peter Zimmermann ist es nicht, das ist nicht sein Klang. Zehetmair auch nicht. Doch? Wahnsinn. Ich kenne ihn aus einer völlig anderen Perspektive. Der Mendelssohn bei uns war so kränklich gespielt. Hut ab, das ist phänomenal. Das Orchester ist auch sehr gut, aber sehr nüchtern vom Klang. Es ist sehr in Richtung Strauss gespielt, Szyma¬nowski sollte etwas leichter sein, durchsichtiger. Ich habe dieses Konzert vor 15 Jahren hier gespielt, mit Mariss Jansons. Als Solist mit dem eigenen Orchester zu spielen, ist phantastisch. Das war wunderbar.
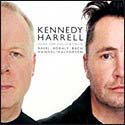
Ravel: Sonate für Violine und Violoncello
Nigel Kennedy (Violine)
Lynn Harrell (Violoncello) 1999
EMI Classics
Ich kenne das, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Ist das Bartók? Ravel? Wenn ich ein Stück nicht gespielt habe, lasse ich mich leichter begeistern, da habe ich keine eigene Meinung, wie es gespielt werden sollte. Es gefällt mir. Beide spielen sehr gut, sie versuchen, es sehr sprechend zu gestalten. Mit diesem Geiger habe ich schon Doppelkonzerte zusammen gespielt? Keine Ahnung. Kennedy? Hätte ich nicht erkannt. Nigel kann phänomenal Geige spielen. Er hat halt ein Faible für Show. Wenn er mit einem Kaffee auf die Bühne kommt, fragt man sich, ob das wirklich sein muss. Aber wenn er zur Geige greift, merkt man: Er ist ein phantastischer Musiker.
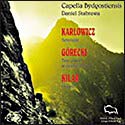
Wojciech Kilar: Orawa
Capella Bydgostiensis
Daniel Stabrawa (Leitung) 1998
Accord
Das muss meine Aufnahme sein! Da kann ich nichts Schlechtes sagen! Das ist eine minimalistische Version von Janáˇcek. Ist das wirklich die Capella? Das gefällt mir! Ihnen auch? Ich dirigiere nur noch sehr wenig, ich habe das Orchester in Bydgoszcz sieben Saisons geleitet, um meinen Horizont zu erweitern. Wenn man dirigieren kann, hilft das sehr als Konzertmeister. Orchestermusiker haben immer das Gefühl, sie könnten es besser machen als der Dirigent. Aber wenn man da vorn steht, merkt man: Dirigieren ist wie Geige spielen, man muss eine unglaubliche Technik haben, man muss wissen, wie es funktioniert. Jede kleine falsche Bewegung überträgt sich aufs Orchester. Dirigieren ist so schwer wie Geige spielen. Ich bräuchte noch zwanzig Jahre, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Aber es gibt auch Dirigenten, die eine tolle Technik haben, bei denen ich mich aber frage, was will er, wozu steht er da?

Beethoven: Violinkonzert
Patricia Kopatchinskaja (Violine)
Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe (Leitung) 2008
naïve
Das klingt nach Alter Musik. Furchtbar, aber damals hat’s vielleicht nicht anders geklungen… Das ist für mich keine Musik, das ist Exekutieren nach bestimmten Regeln. Keine persönliche Aussage. Hier, da muss was passieren, aber nichts. Das hier ist, wenn man den Historikern glaubt, ein Lobgesang auf Napoleon. Und man hört: Nichts. Und hier muss es geheimnisvoll sein – wieder nichts. (Die Geige tritt hinzu.) Das ist einfach idiotisch. Dabei kann er auch schön spielen, oder sie – es klingt nach einer Frau. Man hört nicht das Fleisch im Bogen, sondern Impulse. Sie macht so viele komische Tempi und Rubati, die in der Klassik nichts zu suchen haben. Beethoven als Mensch war exzentrisch, ja, aber nicht als Künstler. Seine Musik ist klassisch, die Konstruktion muss einfach stehen. Warum wird es hier schneller? Wer würde in der Oper so singen? Niemand, das ist gegen die Natur gespielt. Wenn jedes Werk wie neu und improvisiert klingen soll, dann soll man es spielen, ohne zu proben. Dann wäre es authentisch. Aber das hier ist geübt, das hört man doch, hier machen wir es schneller, hier langsamer. Nur: warum? Da ist Nigel Kennedy viel interessanter. Der hat Respekt, der würde Beethoven nie so verunstalten. Beethoven hätte es in jedem Konzert etwas anders gespielt, aber nicht willkürlich. Man darf nicht die Idee zerstören. In der klassischen Architektur kann man eine Fensterreihe anders platzieren oder die Giebel über den Fenstern anders gestalten, aber man darf nicht ein einzelnes Fenster ein halben Meter höher setzen, um die Fassade interessanter zu machen. Das geht nicht. Ich habe Beethovens Manuskript gesehen, und man fragt sich in der Tat, warum die Erstausgabe so und nicht anders aussieht. Aber die Fassung, die wir heute spielen, ist nicht zufällig entstanden, sie hat sich aus der Idee ergeben, die man im Manuskript erkennen kann. So hat sich im Laufe der Zeit eine Tradition der Phrasierungen, der Tempi entwickelt, mit denen diese Idee am besten realisiert wird. Vielleicht hat sich inzwischen zu viel an Tradition abgelagert, aber diese Schichten muss man behutsam abtragen. Wenn man zu viel abschabt, kommt man durch – und es bleibt nichts mehr.

