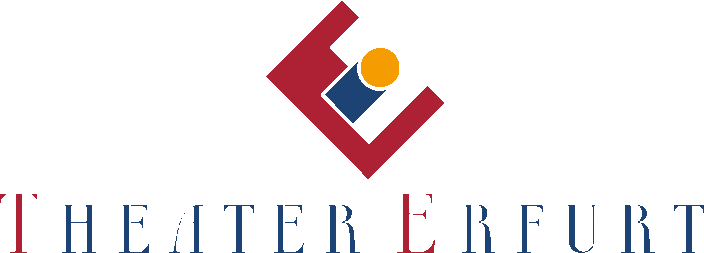Seit zehn Jahren mischt Gabriela Montero die klassische Musikszene gehörig auf. Denn die venezolanische Pianistin tut, was kaum ein klassischer Musiker heute noch kann: improvisieren.
Frau Montero, haben Sie wirklich schon mit sieben Monaten angefangen, Klavier zu spielen?
Das stimmt, da haben mir meine Eltern, angetrieben von meiner Großmutter, ein Zwei-Oktaven-Kinderklavier in mein Bett gelegt. Meine Mutter sang mich jeden Abend in den Schlaf, und ich begann, diese Melodien zu spielen und zu improvisieren. Da merkten meine Eltern, dass ich kein normales Kind war. (lacht) Mit zwei Jahren spielte ich alle diese kleinen Stücke, und meine Mutter machte über 200 Aufnahmen. An meinem dritten Geburtstag bekam ich mein erstes richtiges Klavier. Mit vier bekam ich meinen ersten Unterricht, mit fünf gab ich mein erstes Recital, mit acht mein Orchesterdebüt mit Haydns D-Dur-Konzert. Ich bin mit diesen Genen geboren und bin dafür sehr dankbar.
Waren Ihre Eltern Musiker?
Überhaupt nicht, es gibt in meiner Familie keine Musiker. Ich weiß nicht, warum meine Großmutter auf die Idee mit dem Kinderklavier kam. Es war Intuition. Und meine Eltern hörten so gut wie nie klassische Musik.
Haben Ihre Eltern Sie zum Üben angehalten?
Sie haben mich nie gedrängt. Sie gaben mir immer die Möglichkeit zu lernen, suchten gute Lehrer, nahmen viele Opfer auf sich. Und wenn ich sagte: Ich will nicht Pianistin werden, meinten sie: Dann höre auf. Das war sehr klug. Nach so vielen Jahren der Rebellion gegen mein Talent und meine Bestimmung habe ich schließlich aus mir selbst heraus entschieden: Ja, das ist es, was ich tun will in meinem Leben. Für mich war Klavierspielen wie Atmen. Ich hatte nie das Gefühl, zu arbeiten. Ich übe bis heute nicht viel. Das können alle bestätigen, die mal mit mir zusammengewohnt haben. Irgendwann kommen sie und wundern sich: Du übst nie, wie geht das? Mein Üben ist mehr emotional als technisch. Das mache ich weniger am Klavier. Aber ich bin ein zu 100 Prozent musikalischer Mensch. Alles was ich höre, ist musikalisch, mein Gehirn ist wie ein Radio, es improvisiert immer, spielt immer. Es geht nie aus.
Wann haben Sie gemerkt, Sie sind anders als die anderen?
So habe ich mich immer gefühlt. Ich habe mich immer auf eine Weise sehr allein gefühlt. Mit acht bin ich mit meiner Familie in die USA gezogen, wo ich zehn Jahre blieb. Meine Eltern versuchten mich glücklicherweise vor zu großem Druck zu schützen, auch wenn ich viele Konzerte gab. Ich war immer wieder für einige Tage nicht in der Schule, um Konzerte zu geben oder Wettbewerbe zu spielen – ich habe immer gewonnen. (lacht) Aber ein Wunderkind zu sein ist nie leicht, denn jedes Kind will sein wie die anderen, es will dazugehören, zumindest in der Kultur, aus der ich stamme. Und ich war immer die Außenseiterin. Ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind.
Wie war der Schritt vom Wunderkind zur erwachsenen Musikerin?
Ich habe lange überlegt, ob ich Musikerin werden sollte. Welche Art von Befriedigung wollte ich daraus ziehen, was wollte ich erreichen? Ich wollte mal Psychologin, mal Archäologin werden, aber ich denke, alle meine Talente liegen in der Musik. Ich habe mich früher nie um Erfolg bemüht, es ist immer alles einfach passiert.
Und doch war es ein Weg mit vielen Umwegen.
Mein Leben war ein einziges Auf und Ab. Ich habe für zwei Jahre aufgehört zu spielen, da wollte ich nichts mehr mit Musik zu tun haben. Mal hab ich in einem Restaurant gekellnert, mal in einem Büro gearbeitet – ich habe immer wieder versucht, der Musik zu entfliehen. Aber dann kam ich zu dem wundervollen Lehrer Hamish Milne in London und habe irgendwie wieder angefangen zu spielen und schließlich fünf Jahre an der Royal Academy studiert. Aber dass mir wirklich klar wurde, was Musik für mich bedeutet, und ich mir zum Ziel setzte, so gut zu werden, wie ich kann, da war ich 30. Das war, als ich Martha Argerich traf. Ihr Einfluss war sehr wichtig.
Wie haben Sie sie kennengelernt?
Ich hatte sie schon als Kind kennengelernt, sie ist eine gute Freundin meiner ersten Klavierlehrerin, Lyl Tiempo in Caracas. Sie wohnen nahe beieinander in Brüssel. Ich sprach sie nach einem Konzert in Montreal an, wo ich damals gewohnt habe. Ich habe sie gefragt, wie sie ihr Leben unter einen Hut bekommt als Musikerin, als Mutter, als Frau – ich habe zwei Töchter, 13 und sieben Jahre alt. Sie sagte: Ich habe keine Antworten, aber ich würde dich gerne spielen hören. Und ich sagte: Martha, ich habe zwei Monate lang nicht gespielt – ich hatte damals gar kein Klavier. Aber sie blieb hartnäckig und wir verabredeten uns für den nächsten Abend um acht, sie hatte eine Probe, aber die war noch nicht vorbei, ich wartete, ich ging mit Freunden in eine Bar, wir tranken etwas. Und um 1.30 Uhr in der Nacht kam Martha dann, ok, ich bin fertig. Nun gut, ich spielte etwas Beethoven, Schumann, und ich improvisierte. Sie war sehr beeindruckt, sie war wunderbar. Sie begann mit Leuten über mich zu sprechen, und Leute begannen mich anzurufen und mich einzuladen zu Festivals. Es ist eine wundervolle Freundschaft und Zusammenarbeit geworden.
Gehen Sie gern auf die Bühne – wo Sie als Kind so schüchtern waren?
Das hat sich völlig gewandelt. Ich mag es zu kommunizieren, zu fühlen, dass die Menschen glücklich sind. Vielleicht weil ich mich in meinem Leben oft allein gefühlt habe, mag ich es, den Leuten etwas zu geben. Man teilt etwas miteinander. Viele sagen mir, Gabriela, du wirkst so in dir ruhend auf der Bühne. Warum auch nicht? Wenn man sich auf die richtigen Dinge konzentriert, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Ich möchte etwas sagen, ich habe etwas zu sagen, ich habe eine Menge erlebt, und ich sage das durch Musik.
Sie sind glücklich mit Ihrer Entscheidung, Musikerin zu werden?
Oh ja, ich bin dankbar dafür, dass ich das Leben führen kann, das ich führe. Dass ich klassische Werke spielen und improvisieren kann. Früher habe ich am Ende eines Konzerts improvisiert. Mittlerweile improvisiere ich die ganze zweite Hälfte, auf Themen aus dem Publikum. Es ist so viel einfacher zu improvisieren. Für mich ist es das einfachste – und das schönste auf der Welt. Ein Beethoven-Konzert zu spielen ist etwas ganz anderes. Das ist Musik, die nicht aus mir selbst kommt, aber ich muss sie dazu machen, so gut ich es kann. Um die Wahrheit in dem Stück zu finden.
Warum konzentrieren Sie sich dann nicht aufs Improvisieren?
Ich bewundere Beethoven, Rachmaninow, Schumann, Bach. Ich könnte nicht zu lange von ihnen fern bleiben. Ich liebe Jazz und bewundere Jazz-Musiker – aber ich bin keine Jazz-Musikerin. Ich bin klassisch ausgebildet, da liegen meine Wurzeln. Ich lebe in der klassischen Welt, die ist nur größer für mich geworden, experimenteller.
Entwickeln Sie Ihre Interpretationen intuitiv?
Ja. Ich setze mich nicht hin und analysiere. Als Kind war Musik für mich Spaß, und auch jetzt noch ist das Spielen für mich ganz natürlich. Aber ich treffe jetzt bewusste Entscheidungen, ich denke viel darüber nach, was ich mit einem Stück will. Und dann kommt ein Punkt, da fühle ich, ich komme der Wahrheit so nah wie ich denke, dass ich kommen kann. Das ist mein Ziel. Dann habe ich mein Konzept gefunden. Das wichtigste für mich ist, dass ich nur Werke spiele, die ich wirklich liebe.
Sie leben in den USA. Haben Sie Sehnsucht nach Ihrer Heimat?
Ich vermisse Venezuela, das stimmt. Eine Improvisation auf meiner CD „Solatino“ habe ich Mi Venezuela genannt. Die Stimmung, das Gefühl dahinter ist die Trauer, die Sehnsucht danach, was es mal war – so vieles ist verloren gegangen. Die klassische Musik ist das einzige, was in Venezuela funktioniert, ansonsten fällt das Land auseinander. Die Musik ist die Seele des Landes, der einzige Bereich, in dem man sich frei ausdrücken kann.
Können wir etwas vom venezolanischen Orchestersystem lernen?
Die Leidenschaft, der Enthusiasmus, die Hingabe, die Frische, das ist wunderbar. Klassische Musik als neue Musik zu sehen, als Musik, die lebt. Vielleicht liegt es daran, dass diese Musik nicht Teil unserer Tradition ist. Wir entdecken sie mit Neugier und Spannung. Wir gehen mit einer anderen Energie, auf neuen Wegen an sie heran, vielleicht weil nicht das Gewicht der Tradition auf unseren Schultern lastet.
Und vielleicht auch mit einer anderen Körperlichkeit?
Ja, es ist völlig normal für uns, ein Konzert zu geben und anschließend in einen Salsa-Club zu gehen. Für uns sind Musikmachen, Tanzen, Singen ein natürlicher Teil des Lebens. Als ich 2003 bis 2006 in Venezuela gelebt habe, war es völlig normal, mit Freunden zu Hause zu improvisieren. Jeder auf einem anderen Instrument, ich am Klavier, wenn eines da war. Das ist Teil des Lebens. Und Tanzen ist ein Teil unserer Kultur. Ich finde es sehr spannend, dieses Körperliche mit der klassischen Musik in Verbindung zu bringen.
Haben Sie nicht auch Lust zu komponieren?
Das ist mein nächstes Ziel. Das tue ich ja schon, wenn ich improvisiere, aber bislang habe ich es nie aufgeschrieben, ich hatte nie die Zeit dafür. Es würde mich reizen, für verschiedene Instrumente zu schreiben. Ich liebe das Cello. Und die Gitarre. Und ich mag die tiefen Klänge. Ich bin immer neugierig, der Himmel ist die Grenze.