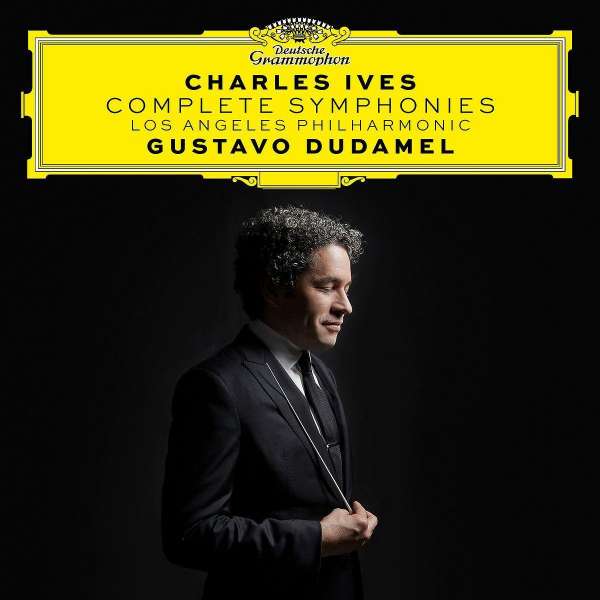„Guten Tag, Maestro.“ Respektvoll begrüßt der Kellner im Salzburger Hotel „Sacher“ den Dirigenten Gustavo Dudamel, der eigentlich nur eins will: möglichst normal behandelt werden. Schließlich sieht er sich als Teamplayer, nicht als Diktator. Auch im Gespräch zeigt er keine Arroganz, der Venezolaner mit den dunklen Locken ist fröhlich und temperamentvoll. Die Worte purzeln förmlich aus ihm heraus, einige Sätze unterstreicht er mit einer flinken Handbewegung.
Herr Dudamel, was liegt ihnen am venezolanischen Simón Bolívar Symphony Orchestra?
Gustavo Dudamel: Dieses Orchester liegt mir besonders am Herzen, es ist meine Familie. Schließlich habe ich über 20 Jahre mit ihm verbracht. Ich fing als Junge im Simón Bolívar National Children‘s Orchestra an, aus dem schließlich das Simón Bolívar Symphony Orchestra wurde. Dass ich inzwischen sein musikalischer Direktor bin, macht mich unheimlich stolz.
Ihre Schützlinge kommen aus Problemfamilien, einige haben früher auf der Straße gelebt. Wie schwer taten sie sich anfangs damit, diszipliniert ein Instrument zu spielen?
Dudamel: Sicherlich gab es hier und da Startschwierigkeiten. Aber die ließen sich bei allen unglaublich schnell überwinden. Ich kann Ihnen genau sagen, warum: Weil das Orchester einem ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Das tut gerade denjenigen gut, die vorher völlig auf sich allein gestellt waren.
Sie selbst dürften als Sohn eines Posaunisten und einer Gesangslehrerin behüteter aufgewachsen sein, oder?
Dudamel: Wir gehörten zwar zur Mittelschicht, wohnten allerdings in einem ärmlichen Stadtviertel. Insofern habe ich hautnah mitbekommen, wie tief man fallen kann. Nicht jeder, mit dem ich aufgewachsen bin, ist heute noch am Leben.
Fragen Sie sich manchmal, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie als Kind nicht kostenlos Musikunterricht bekommen hätten?
Dudamel: Eigentlich war mir immer klar: Ich möchte auf jeden Fall etwas aus mir machen. Trotzdem hätte ich ohne die Musik womöglich auf die schiefe Bahn geraten können. Das ist in meiner Nachbarschaft mit schönster Regelmäßigkeit passiert. Aus netten Jugendlichen wurden plötzlich Kriminelle.
Sie galten als Wunderkind.
Dudamel: Ach was. Ich verfügte nie über Beethovens Genialität, sondern musste hart für meinen Erfolg arbeiten.
Dennoch haben Sie schon mit zwölf Jahren ein Orchester dirigiert.
Dudamel: Das war purer Zufall. Weil der Leiter unseres Jugendorchesters nicht pünktlich war, bin ich einfach eingesprungen. Zuerst haben die anderen Kinder gelacht. Doch fünf Minuten später waren sie ruhig und arbeiteten hochkonzentriert mit mir. Danach wusste ich, dass ich Dirigent werden wollte.
Gehen Sie Ihren Job mittlerweile routinierter an?
Dudamel: Mein Motto ist: Ohne Leidenschaft geht die Magie der Musik verloren. Darum versuche ich stets, ein Orchester für meine Ideen zu begeistern.
Welchen Unterschied macht es für Sie, ob Sie vor Profis oder vor Laien stehen?
Dudamel: Grundsätzlich keinen. Aber die Wiener Philharmoniker zum Beispiel bringen natürlich einen enormen Erfahrungsschatz ein, aus dem ich als Dirigent schöpfen kann.
Mit den Berliner Philharmonikern haben Sie 2013 Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ aufgenommen.
Dudamel: Wie Herbert von Karajan, meinen Sie? Diesem Vergleich muss ich mich jetzt wohl stellen. Mit Sicherheit hat mich seine Einspielung geprägt. Wenn ich sie mir anhörte, begann ich automatisch vor dem Lautsprecher zu dirigieren. Ich malte mir aus, an seiner Stelle zu stehen. So gesehen ist für mich ein Traum Wirklichkeit geworden.
Dudamel: Glauben Sie, dass sich Strauss beim Komponieren an Nietzsches Zarathustra orientierte?
Es ging ihm bestimmt nicht darum, Nietzsches Gedankengut eins zu eins zu vertonen. Eher hat er ein paar von dessen Ideen aufgegriffen und dann nach einer für ihn stimmigen musikalischen Adaption gesucht. Für mich leben sowohl Nietzsches als auch Strauss‘ Werk von ihren Gegensätzen. Mal löst das Licht die Dunkelheit ab, mal mutiert Leidenschaft zu Leere.
Was halten Sie von Nietzsches berühmten Satz „Gott ist tot“?
Dudamel: Dieses berüchtigte Zitat „Gott ist tot.“ mögen einige Leute als reine Provokation empfinden. Meiner Ansicht nach wollte Nietzsche uns bloß daran erinnern, dass wir unser Schicksal letztlich selber in die Hand nehmen müssen. Auch wenn wir Menschen kein Superman sind: In uns steckt mehr Kraft, als wir denken.
Wahrscheinlich geht nicht jeder Katholik so entspannt mit Nietzsches Theorien um wie Sie.
Dudamel: Verstehen Sie mich nicht falsch – meinen Glauben will ich mir nicht nehmen lassen. Im Gegenteil: Ich plädiere dafür, Religion endlich wieder als Symbol für Zusammenwachsen zu sehen. Sie kann uns über Grenzen hinweg näher bringen, statt Hass oder gar Krieg zu schüren.
Und wie stehen Sie zum Papst?
Dudamel: Als Venezolaner freue ich mich riesig, mit Franziskus ein lateinamerikanisches Kirchenoberhaupt zu haben. Vor allem seine Bescheidenheit beeindruckt mich. Binnen kürzester Zeit hat er sich mit den Ärmsten der Armen solidarisiert.
Vermissen Sie Werte wie Natürlichkeit, wenn Sie in Los Angeles sind?
Dudamel: Ich halte diese Stadt gar nicht für so oberflächlich, sie ist sehr weltoffen. Ob Japaner, Chinesen oder Mexikaner, jeder findet dort seinen Platz. Im übrigen mache ich einige Parallelen zwischen Los Angeles und Caracas aus: das schöne Wetter, die Nähe zum Meer.
Reicht Ihnen das, um sich zuhause zu fühlen?
Dudamel: Solange ich meine Frau und meinen Sohn bei mir habe, plagt mich kein Heimweh.
Kommt Ihre Familie tatsächlich nicht zu kurz?
Dudamel: Es fällt mir nicht besonders schwer, Beruf und Privatleben auszutarieren. Als Chefdirigent des Los Angeles Philharmonic Orchestra verbringe ich relativ viel Zeit an einem Ort, ansonsten arbeite ich meistens in Venezuela.
Überhaupt wirken Sie sehr bodenständig. Sie haben nichts Diktatorisches an sich.
Dudamel: Warum auch? Ich sehe mich als Teamplayer, als Teil des Orchesters, nicht als Maestro. Zumindest die Amerikaner haben das akzeptiert. Sie nennen mich einfach Gustavo. Das schätze ich sehr, weil weder ein Dirigent noch die Klassik an sich auf einen Sockel gehoben werden sollte. Ich lehne die Trennung zwischen E- und U-Musik ab.
Heißt das, Sie haben nichts gegen Crossover?
Dudamel: Klassik, Jazz, Rock oder Pop sind für mich absolut gleichwertig. Deshalb habe ich im vergangenen Jahr bei einem Konzert auf dem Flughafen von Caracas vor mehr als 200.000 Zuschauern das Simón Bolívar Symphony Orchestra mit der Simón Bolívar Salsa Band und dem Latino-Sänger Rubén Blades zusammengebracht. Solche Projekte liegen mir am Herzen. Denn ich möchte zeigen, dass Musik eine universelle Sprache ist.
Ohne die uns etwas fehlte?
Dudamel: Genau. Es rührt mich, wie sehr besonders Jugendliche für ihre Instrumente brennen. Sie geben bei einem Auftritt mit ihrem Orchester alles. Dieser „Miteinander sind wir stark“-Moment lässt sie menschlich reifen. Sie wachsen zu verantwortungsbewussten Bürgern heran und geben später ihre Begeisterung für die Musik an die nächste Generation weiter.