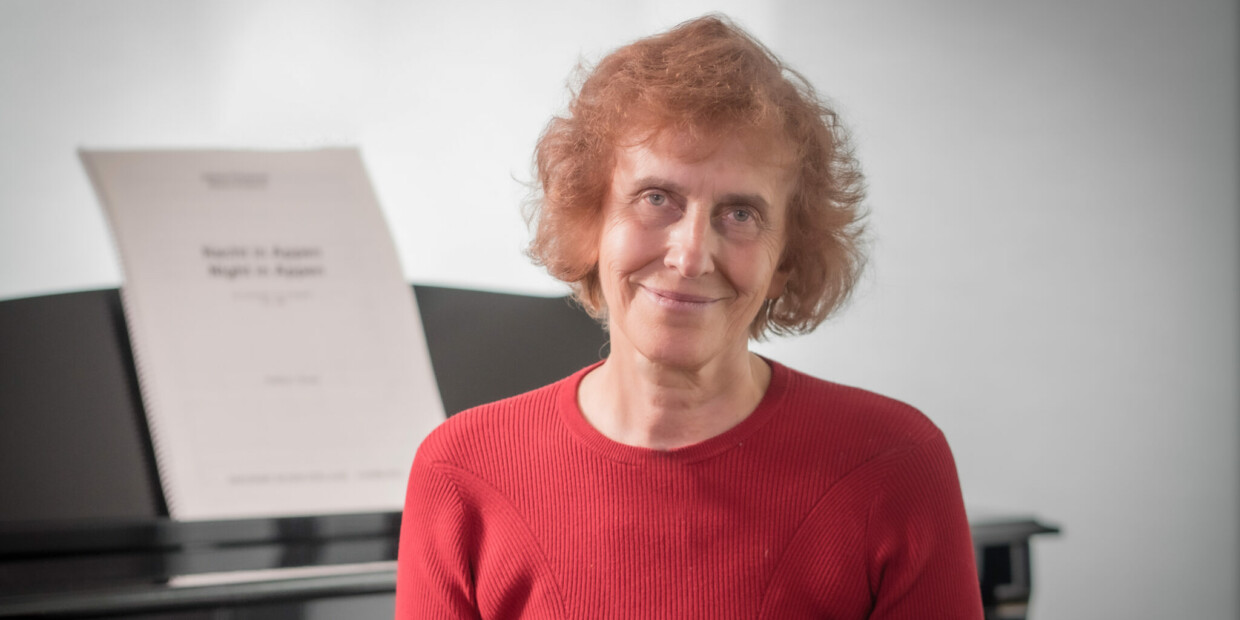Mit mehreren Konzerten würdigt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in der laufenden Saison die Komponistin Jelena Firssowa, unter anderem mit Aufführungen ihrer sinfonischen Werke „Nacht in Appen“ und „Ornamente der Freude“. Ebenso erklingt Musik ihres Ehemanns Dmitri Smirnow. Das Komponistenpaar lebte 48 Jahre zusammen, zunächst in Moskau und ab 1991 in England, wo Smirnow 2020 an einer Corona-Erkrankung verstarb. Postum wird am 26. und 27. Februar sein Werk „Russlands Geschichte in vier Hymnen“ im Konzerthaus und in der Berliner Philharmonie uraufgeführt.
Frau Firssowa, Ihr Vater war in der Sowjetunion ein prominenter Physiker. Betrachten Sie das Komponieren auch als eine Art Forschung?
Jelena Firssowa: Nein, ich habe Komposition nie als Wissenschaft gesehen. Ich habe mich seit meiner Kindheit mit Musik beschäftigt, habe immer geschrieben wie ich wollte. Komposition ist für mich einfach der beste Ausdruck für meine Liebe zur Musik.
Wie reagierte Ihr Vater, als Sie beschlossen, Komponistin zu werden?
Firssowa: Am Anfang war er verärgert, denn für ihn gab es auf der Welt einfach nichts Besseres, als sich mit Physik und insbesondere mit der Atomphysik zu beschäftigen. Er ging davon aus, dass auch ich Physikerin werde, und als ich mich anders entschied, war er darüber nicht erfreut. Aber mit der Zeit wandelte sich das und am Ende war er sogar stolz darauf.
Aktuell sind Sie „Composer in Residence“ beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Inwiefern ist dies mit täglicher Kompositionsarbeit verbunden?
Firssowa: Über die Saison werden verschiedene Werke von mir aufgeführt, auch zwei Auftragswerke, die ich zuvor in London geschrieben habe. Ich komponiere im Moment fast täglich, meistens ein paar Stunden am Morgen und am Nachmittag. Vor allem nach dem Tod meines Mannes vor zwei Jahren habe ich viel mehr geschrieben als gewöhnlich. Da war die Musik wie eine Rettung für mich, ich weiß nicht, wie ich ohne sie diese tragische Zeit überstanden hätte. Ich habe Musik geschrieben, um nicht verrückt zu werden.
Ihr Mann Dmitri Smirnow war ebenfalls Komponist. Haben Sie manchmal Werke zusammen komponiert?
Firssowa: Nein, wir haben nie gemeinsam am gleichen Stück gearbeitet. Allerdings haben wir uns ein Werk manchmal aufgeteilt, etwa die Musik zu einer Fernsehfilm-Serie über die Eremitage, wo wir uns bei den zu vertonenden Szenen abgewechselt haben. Es gibt auch das Quartett „La Divina Comedia“, für das sowohl mein Mann und ich jeweils einen Satz geschrieben haben, als auch unsere Tochter Alisa. Das waren aber eher Ausnahmen. Mein Mann und ich hatten natürlich ähnliche Vorlieben und Einflüsse, etwa die Prägung durch Edisson Denissow. Insofern hat unsere Musik Gemeinsamkeiten in Technik und Stil. Wir haben uns unsere Werke auch immer gegenseitig gezeigt und vorgespielt. Dieser Austausch über die Arbeit fehlt mir jetzt sehr.
Sie erwähnten Edisson Denissow – welche anderen Komponisten haben Sie beeinflusst?
Firssowa: Denissow kannten wir ja persönlich, er hat uns sehr viel beigebracht, wir haben uns viel mit ihm unterhalten, seine Partituren studiert und daraus gelernt. Ansonsten waren für mich die wichtigsten Einflüsse Bach und Beethoven, die Neue Wiener Schule und auch Sofia Gubaidulina und Alfred Schnittke, deren Technik mich sehr interessierte.
Ende Februar wird postum in Berlin Dmitri Smirnows Werk „Russlands Geschichte in vier Hymnen“ für Cello und Orchester uraufgeführt. Welchen Hintergrund hat dieses Werk?
Firssowa: Es ist wahrscheinlich die einzige Komposition von Dima, die man politisch nennen könnte. Denn ansonsten waren wir immer der Meinung, dass Politik nicht in unsere Musik gehört, ästhetisch passte es schlicht nicht zusammen. Den Impuls für dieses Werk gab ursprünglich Mstislaw Rostropowitsch, mit dem wir befreundet waren. Einmal saßen wir mit ihm in England im Restaurant, Anfang 2001, kurz nachdem in Russland auf Geheiß Putins die stalinistische Hymne wieder zur Nationalhymne gemacht worden war. In den Jahren davor hatte sie Boris Jelzin durch ein Stück von Michail Glinka ersetzt. Und über diese Rückkehr zur Stalin-Hymne war Rostropowitsch an diesem Abend sehr wütend, er rief Dinge wie „was soll dieser Unfug“ und „ich fahre nie wieder nach Russland“ laut durch das ganze Restaurant. Daraufhin hat Dima ihm vorgeschlagen, ein sarkastisches Stück zu schreiben, basierend auf den vier russischen Hymnen: der Zaren-Hymne, der Internationalen, dem Lied von Glinka und der Stalin-Hymne. Die Idee gefiel Rostropowitsch, er gab den Kompositionsauftrag, woraufhin Dima das Werk innerhalb eines Monats geschrieben hat.

Und doch ist es bis heute nie aufgeführt worden.
Firssowa: Weil sich die Situation für Rostropowitsch änderte. Er lebte ja in Europa, näherte sich Russland aber wieder an, reiste dorthin und baute zur Regierung ein diplomatisches Verhältnis auf. Man begann, ihn in Russland zu hofieren, Putin verlieh ihm auch einen Orden. Uns hat er immer versichert, dass er das Werk trotzdem zur Aufführung bringen wird, aber ich denke, dass er am Ende sein Verhältnis zu Putin nicht durch so einen politischen Seitenhieb beschädigen wollte.
Sie und Ihr Mann sind 1991 aus Russland emigriert, auch weil Ihre Musik in den achtziger Jahren durch den sowjetischen Komponistenverband diffamiert wurde. Ging es damals tatsächlich um Stilistik – oder spielte auch die Eitelkeit des Vorsitzenden Tichon Chrennikow eine Rolle, dessen Werke man im Westen nicht spielte, im Gegensatz zu Ihren?
Firssowa: Dieser Aspekt hat sicherlich dazu beigetragen. Chrennikow war beleidigt, dass man damals bei einem großen Festival in Köln oder auch in Paris Werke von Dima und mir aufführte, aber keine von ihm. Ausschlaggebend war aber vor allem, dass Chrennikow die damalige Avantgarde grundlegend ablehnte. Dieses Denken fußte immer noch auf der stalinistischen Ideologie, dass die Musik auch dem „einfachen“ Volk verständlich sein müsste. So dachte man auch am Konservatorium: Prokofjew und Schostakowitsch galten als das Maß der Dinge, in diesem Rahmen sollte man sich bewegen. Was musikalisch darüber hinaus ging, wurde als elitär oder schädlicher westlicher Einfluss angesehen – und nach Aufführungen wurden diese Werke auch jedes Mal von der Presse niedergemacht.
War das nicht schmerzhaft für Sie?
Firssowa: Ach, wir waren diesen Umstand irgendwann gewohnt und haben dem nicht besonders Beachtung geschenkt. Wir wussten ja auch, dass die Generation vor uns – mit Denissow, Schnittke und Gubaidulina – es noch schwerer hatte. Einmal wollte Gubaidulina zu einem Geburtstags-Konzert in den Westen reisen, doch Chrennikow verhinderte ihre Ausreise und forderte sie auf, unter falschem Vorwand abzusagen, was sie aber ablehnte. Erst später, während der Perestroika, wurde es mit den Visa einfacher. In Russland selbst bot einem das Leben als Komponist aber auch bestimmte Privilegien, wie zum Beispiel der Aufenthalt in staatlichen Künstler-Einrichtungen, wo man unter sehr guten Bedingungen arbeiten konnte. Und unsere Musik wurde ja aufgeführt, etwa bei Konzerten im Moskauer „Haus der Komponisten“, die immer randvoll mit Publikum waren. Insofern war es für uns kein unglückliches Leben.
Hatten Sie es als Komponistin in der Sowjetunion schwerer als Ihre männlichen Kollegen?
Firssowa: Nein. Sicher gab es auch Vorurteile und manche Männer trauten einem das Komponieren nicht zu. Aber so etwas spielte für mich keine Rolle, da ich ganz anders erzogen und aufgewachsen bin. Mein Vater hatte als Physiker viele weibliche Kolleginnen, das war völlig normal. Auch im Verband der Komponisten gab es viele Frauen. In der Sowjetunion habe ich keine Geschlechterdiskriminierung gespürt – um so mehr wunderte ich mich dann später im Westen, wo in den neunziger Jahren noch eine viel größere Ungleichheit herrschte.
Dass Künstler aus politischen Gründen diffamiert, oder wie in Deutschland „verfemt“ wurden – halten Sie so etwas für die Zukunft für ausgeschlossen?
Firssowa: Das hängt von der Politik des betreffenden Landes ab. In einem totalitären Regime könnte es so etwas theoretisch noch geben, wobei ich es mir in der Praxis kaum vorstellen kann – auch in Putins Russland nicht. Selbst wenn Russland heute ein totalitäres Regime ist, wird auf die Kultur nicht so stark Einfluss genommen. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen weniger staatliche Unterstützung, aber Verbote halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, dass die heutigen Politiker begriffen haben, dass sie Ästhetik nicht mit Gesetzen beeinflussen können.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie heute auf Russland?
Firssowa: Ich lebe ja schon seit über dreißig Jahren nicht mehr dort. Auch die meisten meiner Freunde sind inzwischen ausgewandert, insofern verspüre ich keine Nostalgie oder Heimweh. Im Moment scheint mir die Situation in Russland sehr trist zu sein, ob es nun der Konflikt mit der Ukraine ist, die Zensur oder die vielen Verhaftungen bei Demonstrationen. In den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das noch anders, da gab es schon eine gewisse Hoffnung auf das Entstehen einer Demokratie. Von dieser Hoffnung ist heute nur noch wenig übrig.