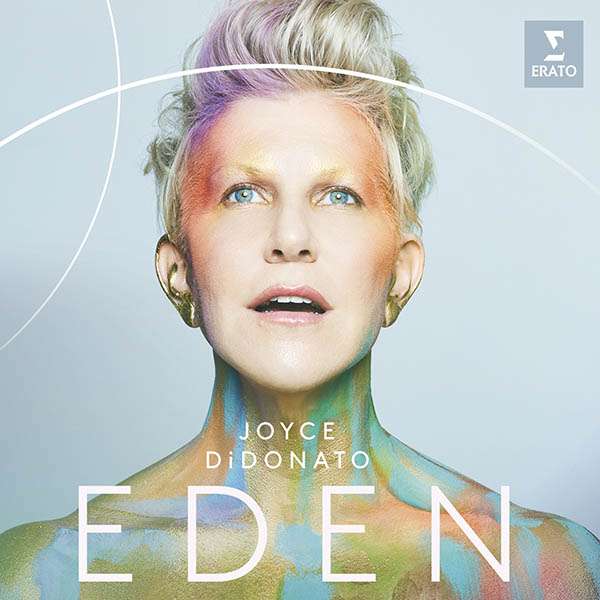Ihr gehört eine der aufregendsten Opernstimmen unserer Zeit: Agilität, Eros und das sehr persönliche Timbre ihres Mezzosoprans stellt Joyce DiDonato derzeit am liebsten in den Dienst der Belcanto-Meister Bellini, Donizetti und Rossini. Am Morgen nach einer fulminanten Vorstellung von Donizettis Maria Stuarda an der Deutschen Oper Berlin gibt die Amerikanerin offenherzig Auskunft – auch über den schwierigen Start ihrer Karriere.
Ihr Weg an die Opernhäuser in London und New York, Mailand und München war zu Beginn Ihrer Karriere keineswegs vorgezeichnet. Wie sind Sie mit negativen Antworten nach Vorsingen umgegangen?
Ich musste in der Tat heftige Kritik einstecken. Nach 13 Vorsingen in Europa gab es zunächst genau ein „Ja“. Nach der anfänglichen Enttäuschung habe ich mich gefragt, warum diese Leute mich so negativ einschätzten. Niederschmetternde Aussagen wie die, meine Kunst hätte mit Oper wenig zu tun, haben mich zum Nachdenken gebracht. Kritik an meiner Stimme kannte ich schon, solche an meiner Integrität und Aussagekraft als Künstlerin nicht. Mir wurde klar: Meinen Klang produziere ich gut, ich hatte ein tolles Coaching genossen, ja, ich war eine Opernsängerin. Das hatte also gar nichts mit mir zu tun, sondern mit den Erwartungen an mich, ins Muster einer amerikanischen Opernsängerin zu passen. Ich lernte, nicht mehr Erwartungen zu erfüllen, sondern meine Stimme zu finden, mir zu vertrauen.
Gab es einen Wendepunkt in Ihrem Leben, an dem Sie sich bewusst wurden: „Ja, ich bin eine Sängerin“?
Den gab es. Ich war Cover für Jennifer Larmore als Ruggiero in Händels Alcina, die Robert Carsen in Chicago inszenierte – mit noch anderen Stars wie Renée Fleming, Natalie Dessay und Rockwell Blake. Da saß ich im Zuschauerraum, hatte die Partie drauf, und es gab diesen Moment der Inspiration, in dem mir bewusst wurde, dass ich bereit bin. Es ging nicht darum, im Falle des Falles besser oder schlechter als meine große Kollegin zu sein, aber die Vorstellung, da oben zu stehen, war nicht mehr furchteinflößend. Mir wurde klar, dass ich auf die Bühne gehöre.
Dem langsamen Weg durch amerikanische Häuser mit oft sehr kleinen Partien folgte dann gleich der Sprung an die europäischen A-Häuser. Sie mussten lernen, ein Star zu sein. Reflektieren Sie die Gefahr, damit jemand anderes zu werden?
Nun, ich bin ja in dieses Star-Sein nicht hineingesprungen, sondern hatte einen Weg voller Rückschläge hinter mir. Wenn ich jetzt gerade Donizettis Maria Stuarda singe, dann scheint doch hinter mir diese enorme Reihe an Stars zu stehen: die Baker, die Caballé, die Sutherland oder die Devia. Ich traf rechtzeitig eine sehr bewusste Entscheidung, niemals so sein zu wollen wie andere Sänger, niemanden imitieren zu wollen. Aber wenn ich jene großen Kolleginnen auf Aufnahmen höre, denke ich natürlich oft: „Mein Gott, ich habe noch unglaublich viel Arbeit vor mir.“
Wie gehen Sie damit um?
Ich besitze durchaus einen Glauben an das, was ich bereits erreicht habe. Aber dann ist nach jeder Vorstellung wieder nur Disziplin gefragt und die strenge Analyse: „War es ein guter, ein mittelmäßiger oder schlechter Abend, den ich da gesungen habe?“ Es geht also nur darum, mit mir selbst zu konkurrieren. Dieses Star-Gerede aber hat keine besondere Bedeutung für mich. Dazu ist es sowieso viel zu kurzlebig: Da draußen wartet bestimmt jemand, der diese Rolle übernehmen möchte.
Was bedeutet es Ihnen, auf der Bühne ans Limit zu gehen, Risiken zu wagen – und dabei pure Perfektion aufzugeben?
Ich suche nach Perfektion, wenn ich mich auf eine Rolle und einen konkreten Auftritt beim Aufwärmen vorbereite. Während der Vorstellung aber gebe ich mir selbst die Erlaubnis, nicht perfekt zu sein. Der Begriff „Perfektion“ ist da überhaupt nicht mehr auf meinem Radar. Sie zu verlassen, wäre also kein Versagen für mich. Ich würde allerdings nicht sagen, dass es dabei mein Ziel ist, Risiken einzugehen, aber ich möchte so frei wie möglich sein, den Menschen wirklich die Rolle zu vermitteln, die ich darstellen darf. Das heißt: Ich springe auf die Bühne und hoffe, dass mein Fallschirm sich dabei öffnet.
Ihr Repertoire des Belcanto wird von Kritikern gern der Künstlichkeit und bloßen Schönheit verdächtigt, also nicht der Wahrhaftigkeit, die Sie als Sängerin anstreben. Was entgegnen Sie?
Der Belcanto führt uns in die sublimsten Landschaften der Expression und des Gefühls. Denken Sie nur an Bellinis Arie „Casta Diva“ in der Norma. Da durchschreiten wir einen so puren, so konzentrierten, so ungefilterten Weg der Kunst, ein absolut nicht-intellektuelles Abenteuer. Die Kritik am Belcanto verstehe ich aber, zumal dann, wenn Sänger eben nur den hübschen Klang in den Mittelpunkt stellen. Hingegen bewundere ich eine Maria Callas als das beste Beispiel dafür, was Belcanto sein kann. Es muss hier die Aufgabe von uns Sängern sein, dass die Stimme den Emotionen dient. Schließlich steht die Stimme doch ganz im Mittelpunkt, nicht das Orchester, vielleicht auch nicht so sehr das Drama an sich, das viele Menschen in manchen Opern des Belcanto für blöd halten.
Und wie kommt die Wahrhaftigkeit zum Tragen?
Diese Dramen bieten wunderbare Anlässe, mit wirklich allen Mitteln des Vokalen jene Gefühlslandschaften zu erkunden, die unser Alltag kaum kennt. Wahre – und eben nicht nur reine – Schönheit entsteht eben dann, wenn der Charakter einer Figur durch den Gesang offenbar wird. Hier kommt dann die eigene sängerische Persönlichkeit ins Spiel: Cecilia Bartolis Angelina in Rossinis La Cenerentola ist eine andere als meine, da wir die Figur durch ein unterschiedliches Instrument zum Leben erwecken.
Schließt „wahrer“ Schöngesang dann auch bewusst hässliche Töne ein?
Natürlich. Denken Sie nur an die blutige Geschichte der Maria Stuarda. Da verlangt es die Intensität der Situationen, wirklich alle vokalen Farben einzusetzen, im Zweifel auch düstere und hässliche.
Für Ihre aktuelle CD haben Sie sich auf Spurensuche nach verschütteten Kostbarkeiten des Belcanto gemacht. Gibt es da wirklich noch tolle Entdeckungen zu machen?
Wir haben über 500 Titel aus der Hochzeit des Belcanto durchforstet und Wunderbares aufgespürt in manchen kaum bekannten Opern von Pacini, Carafa, Valentini und Mercadante. Die Oper Stella di Napoli von Pacini gibt der CD ihren Titel. Als die Aufnahme geschafft war, haben wir gesagt: „Da müssen sich die Leute aber anschnallen beim Hören.“ Man darf also gespannt sein.
Wie nehmen Sie in Amerika die Diskussion um das Regietheater war? Dekonstruktion ist in Ihrer Heimat kaum angesagt …
Ich habe entsetzlich langweilige altmodische Inszenierungen gesehen und fantastische moderne Regiearbeiten, glaube aber nicht, dass es darum geht, fortschrittliche und traditionelle Interpretationen gegeneinander auszuspielen. Für mich geht es in der Oper darum, Geschichten auf verblüffende Weise zu erzählen, gern ästhetisch ambitioniert und herausfordernd. Aber ich gebe zu, kein großer Fan von allzu konzeptverliebter, rein verkopfter Regie zu sein.
Gibt es für Ihre Stimme natürliche Repertoiregrenzen? Oder wäre die Amneris, die böse Mezzo-Hexe aus Verdis Aida, irgendwann doch denkbar?
Im Moment glaube ich, keinen Verdi singen zu müssen. Ich denke gern genau darüber nach, was ich einer Rolle mit meiner Stimme und meiner Persönlichkeit hinzufügen kann. Und das wäre dann wohl keine Amneris.
Auch nicht die Eboli in Don Carlo?
Naja, die Eboli könnte ich mir eines Tages schon vorstellen, dann wahrscheinlich in der französischen Fassung.
Wem vertrauen Sie als kritischehrlichem Hörer, wenn es um ihre eigene Leistung geht?
Wir können uns als Sänger ja niemals wirklich selbst zuhören, selbst wenn wir eine Vorstellung aufnehmen, spiegelt das nicht den authentischen Eindruck im Saal wider. Das überschwängliche Lob von Fans oder Freunden: „Du warst sagenhaft“, tut zwar gut. Aber wirklich wichtig sind Menschen, die meine Stimme und mich persönlich gut kennen, die einschätzen können, dass ich müde war und nicht meine komplette Kapazität abrufen konnte. Besonders wichtig sind auch alle jene Freunde und Familienmitglieder, die mit Oper eigentlich nichts zu tun haben: Mit denen kann ich über ganz andere, eben ganz normale Dinge reden.