„Das ist natürlich gefährlich, wenn ich jetzt frei von der Leber weg kritisiere. Schlimmstenfalls ist es ja meine eigene Aufnahme. Aber na gut…“ Kolja Blacher sitzt gespannt auf dem heimischen Sofa, die Fernbedienung in der Hand und bildet sich dann jeweils ziemlich schnell ein Urteil. Blacher, 1963 in Berlin geboren, ist seit den 80er Jahren sehr erfolgreich als Solist. Er war 1993-99 Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und ist seit der Gründung 2003 Konzertmeister des von Claudio Abbado geleiteten Lucerne Festival Orchestra. Zehn Jahre war er Professor in Hamburg, seit 2009 unterrichtet er an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.
 Debussy: Sonate für Violine und Klavier g-Moll
Debussy: Sonate für Violine und Klavier g-Moll
Midori (Violine), Robert McDonald (Klavier) 2001
Sony Classical
Das ist die übliche Interpretationsweise, viel schneller als Debussys Metronomzahl, die zugegebenermaßen zu langsam ist. Es ist super sauber gepielt, ein schöner Klang, überhaupt keine Frage. Aber diese Musik muss unglaublich sinnlich und farbenreich sein, das sind mir hier zu wenige Farben. Und es wird immer übersehen, dass das Stück sehr konstruiert ist. Der Impressionismus ist klanglich sehr frei, aber Debussy hat seine Musik unheimlich genau konstruiert und notiert. Hier wird gar nicht gelesen, was in den Noten steht. Artikulation, Tempo, Ritardando – das muss man nur machen, es steht alles da. Viele Studenten spielen dieses Stück, und es klingt immer genau so. Und dann sage ich: Guck mal, was da in den Noten steht, schau dir mal die Relation der Tempi an. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Das klingt sehr gut hier. Aber wenn man die Partitur kennt, denkt man eben doch, da fehlt einiges. Midori? Komisch, sie ist eigentlich eine ganz Disziplinierte, ich schätze sie sehr. Ich habe ein ganz tolles Schostakowitsch-Konzert mit ihr erlebt – als Konzertmeister der Philharmoniker. Und ihr Buch hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß noch, wie ich bei Dorothy DeLay an der Juillard School in New York studiert habe und Midori da als junge Schülerin rumlief, da hieß es immer: Das ist das Mädchen, das schon mit allen Orchestern gespielt hat.
 Bach: Sonate Nr. 2 a-Moll BWV 1003
Bach: Sonate Nr. 2 a-Moll BWV 1003
Ilya Gringolts (Violine) 2002
Deutsche Grammophon
Gefällt mir sehr, obwohl ich diesen Satz ganz anders spiele. Es ist historisch informiert gespielt. … Ja, es ist eine moderne Geige, normale Stimmung. … Klare Diktion. Ich kann nur raten: Tetzlaff, Zehetmair. Gringolts? Erstaunlich, er hat bei Perlman studiert, das ist stilistisch ganz weit weg von dem, wo er herkommt. Es ist sehr konsequent gespielt. Finde ich sehr interessant. Ich kenne ihn aus dem Orchester in Luzern und von Kammermusik. Das hätte ich nicht erwartet. Ich bin mit Bach und Szeryng großgeworden. Es hieß immer, ich würde Bach so gut spielen. Dann kam die Alte-Musik-Welle und ich war mit einem neuen Instrument vollkommen out. Ich war total verunsichert, habe vieles versucht mit tieferer Stimmung, Barockbogen, ohne Vibrato, weg vom Schönspielen. Es ging zeitweilig soweit, dass ich mich überhaupt nicht mehr getraut habe, diese Sachen zu spielen. Ich hatte einfach den Bezug verloren. … Nein, ich habe kein absolutes Gehör, aber man hört, dass es eine moderne Stimmung ist. Wenn man mit der Stimmung auch nur einen Viertelton runtergeht, klingen die Harmonien anders, man hört die verschiedenen Charaktere der Harmonien stärker und hat mehr Obertöne. Geigerisch gesprochen: Man muss überhaupt nicht mehr ins Instrument rein, man reißt die Saite an und es klingt.
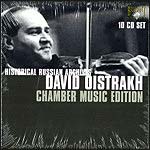 Prokofjiew: Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 f-Moll op. 80
Prokofjiew: Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 f-Moll op. 80
David Oistrach (Violine), Lev Oborin (Klavier) 1946
Brilliant Classics
Der Anfang ist viel zu schön. … Das ist ein Geiger der älteren Generation, das hört man am Vibrato – das meine ich positiv. Es ist ein phantastischer Klang, der einen packt. … Es ist mir hier auch zu freundlich. … Ich tippe mal, es ist ein Russe. … Oistrach, oder? Das höre ich an der Art der Tongebung. Er beginnt mit großer Bogengeschwindigkeit, er bringt die Saite schnell zum Klingen und lässt dann den Klang ausschwingen. Das ist ein Charakteristikum der russischen Schule. Haifetz, Milstein spielen sehr ähnlich, aber sie haben ein anderes Vibrato. Ist das ein Live-Mitschnitt? Wenn ich live spiele, lasse ich mein Vibrato relativ groß, um den Saal zu füllen, bei einer Produktion vor dem Mikro muss man es einschränken. Ich habe eine Aufnahme von Schostakowitsch mit ihm und Richter. Ich denke, in dieser Musik ist auch Hässlichkeit drin, aber Oistrach bleibt immer schön und nobel, das ist typisch für ihn. Aber er packt einen. Oistrach war der Hausgott meiner ersten Lehrerin. Als Kind habe ich fast nur Oistrach gehört – und Perlman.
 Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado 1999
Deutsche Grammophon
Ich könnte jetzt sagen, die Wiener oder die Berliner. Aber da kann man sich täuschen, die Orchester sind heute alle so gut und werden sich immer ähnlicher. … Gut, die Berliner. Bei aller Opulenz bleibt es schlank und elegant, das ist nicht Karajan. Obwohl dem sehr viel Unrecht getan wird. Wenn man die alten Aufnahmen hört – die sind einfach sensationell. … Bei Rattle wäre es etwas härter konturiert. Ja, ich bin mir sicher, das ist Abbado. Diese Symphonie habe ich nie mit ihm gemacht, als die Aufnahme entstand, war ich gerade weg aus dem Orchester. … Ich habe das nie bereut. Ich spiele ja jeden Sommer in Luzern. Das Orchester dort aufzubauen war unglaublich spannend. 120 Leute, die sich nicht kennen, zusammenzufügen, Leute wie das Alban-Berg- oder das Hagen-Quartett, die nie im Orchester gespielt haben. Aber es funktioniert. Ich hatte ja vor meiner Zeit bei den Berliner Philharmonikern auch keine Orchestererfahrung. Man hat mich aus dem Orchester heraus angesprochen. Und ich hatte damals große Zweifel am Musikbetrieb, immer so allein als Solist durch die Welt zu reisen. Nun hab ich durch die Professur ein Standbein, ich habe vier Kinder, die will ich aufwachsen sehen. Da muss ich haushalten.
Ich mache jetzt immer häufiger Konzerte ohne Dirigent, wo ich das Orchester als Solist oder vom Konzertmeisterpult aus leite. Das geht gut bei Haydn, Mozart, den frühen Beethoven-Sinfonien, auch bei den Violinkonzerten von Beethoven, Brahms, Schumann. Das verlangt von den Orchestermusikern viel mehr Eigenverantwortung. Aber dieses kammermusikalische Verständnis macht auch die Qualität der großen Orchester aus, das habe ich bei den Philharmonikern erlebt und erlebe es jetzt in Luzern. In Melbourne habe ich Schönbergs Verklärte Nacht mit einem riesigen Streicherapparat gemacht, 14 erste Geigen, geleitet vom Konzertmeisterpult aus. Das ist erst mal beängstigend, das Stück ist ja wirklich nicht unkompliziert. Aber es macht Spaß. Und die paar schwierigen Stellen, die nicht zusammen waren, die sind auch oft mit Dirigent nicht zusammen.
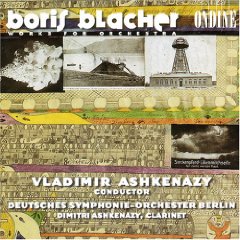 Blacher: Concertante Musik
Blacher: Concertante Musik
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
Vladimir Ashkenazy (Leitung) 1997
Ondine
Ich bin natürlich parteiisch, aber ich habe bei den Traunsteiner Sommerkonzerten nach langer Zeit viele Werke meines Vaters wiedergehört, und ich muss sagen, das ist überwiegend sehr gute Musik! Aber sie wird kaum aufgeführt. Sein Problem war, dass er immer seinen ganz eigenen Weg gegangen ist, er gehörte keiner Schule an. Seine Musik war harmonisch viel zu „einfach“, und er hat als Direktor der Berliner Musikhochschule Sprüche gebracht wie: Tschaikowsky ist mindestens so gut wie Brahms. Da war er natürlich unten durch. Durch seine ungewöhnliche Biografie passt mein Vater politisch in kein Bild, und das spielt heute eine große Rolle. Als Kind war es furchtbar für mich, immer der Sohn zu sein. Du machst ja nur Karriere, weil du der Sohn bist usw., das haut einem schon ins Selbstbewusstsein. Geprägt hat es mich insofern, als ich eine klare handwerkliche Beziehung zum Komponieren habe. Wie er gearbeitet hat, das war sehr nüchtern, überhaupt nicht von genialer Inspiration geprägt. Er war auch sehr pragmatisch. Er hat den Musikern immer gesagt, macht, wie ihr es für richtig haltet. Urtexte sind enorm wichtig, aber diese mitunter groteske Texttreue hier in Deutschland ist auch grauenhaft. Da habe ich von Zuhause, glaube ich, eine gute Mischung aus Respekt vor dem Text und praktikabler Herangehensweise mitbekommen. Das kommt mir jetzt zugute, wenn ich Konzerte von Weill oder Hindemith mache, die ja nie gespielt werden, auch weil sie furchtbar unpraktisch geschrieben sind. Da nehme ich mir die Freiheit zu sagen, diese Bindung lasse ich weg oder jene Note setze ich eine Oktave tiefer – und dann klingt es. Das widerspricht auch nicht dem, was ich zum Debussy gesagt habe. Ehe man sich sklavisch an eine zu langsame Metronomzahl hält, dann lieber eine ganz eigene Sichtweise.


