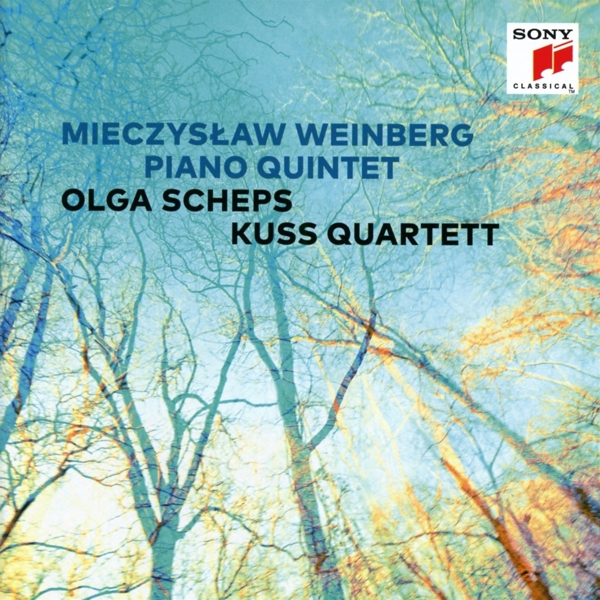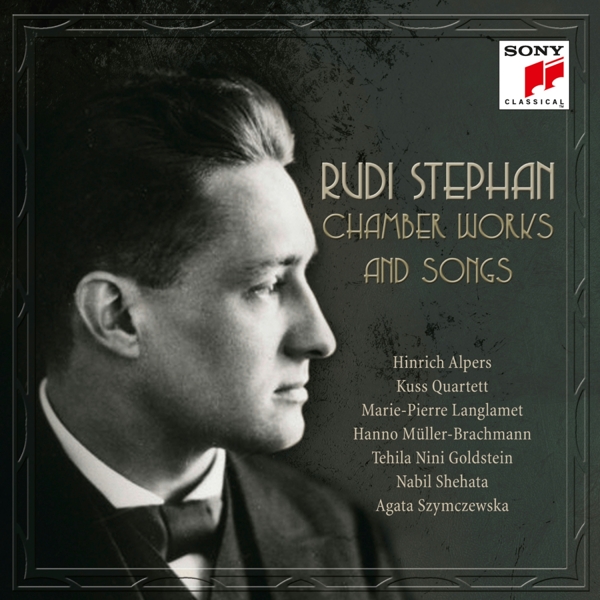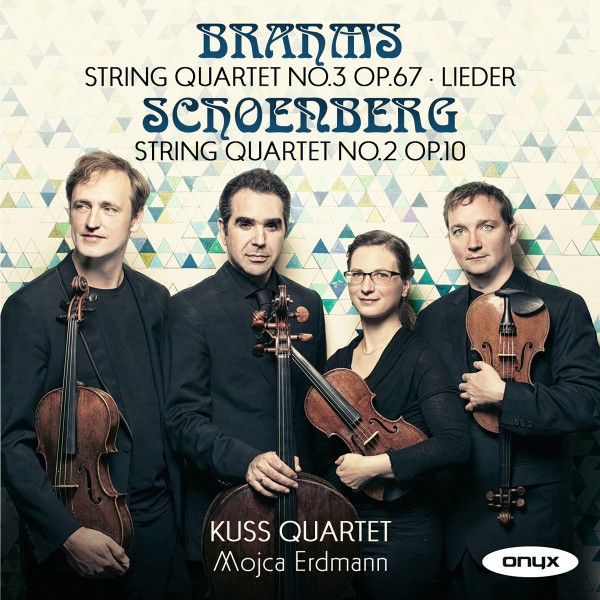Mit 14 Jahren gründeten Jana Kuss, Oliver Wille und zwei Mitschüler des Berliner Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach ein Streichquartett. Heute, zwanzig Jahre später, gilt das Kuss Quartett, seit 2001 in der Besetzung mit William Coleman und Mikayel Hakhnazaryan, als eines der führenden Streichquartette der Welt. Eines, das ganz eigene Wege geht: So spielen sie in Berlin regelmäßig im Techno-Club Watergate, in der Hamburger Laeiszhalle geben sie von Oliver Wille moderierte „Explica“-Konzerte. Wille ist seit dem Wintersemester 2011/12 Professor für Streicherkammermusik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Er hört jeweils einige Minuten zu und spricht dann erst, wenn die Musik abgestellt ist. Wir hören jeweils den Beginn des ersten Satzes.
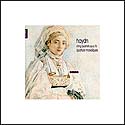 Haydn: Streichquartett op. 76 Nr. 1
Haydn: Streichquartett op. 76 Nr. 1
quatuor mosaiques 1998
Astreé
Das ist eine Aufnahme, die der historischen Spielpraxis verpflichtet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das quatuor mosaiques ist, das ja da die Maßstäbe gesetzt hat. Eigentlich wirkt es bei ihnen nie angestrengt, auch wenn es dramatisch wird. Hier erscheint es mir im forte teilweise unentspannt – vielleicht aber auch nur, weil wir das Stück etwas anders spielen. Ich muss mich immer erst daran gewöhnen, dass sie einen halben Ton tiefer spielen. Was mir an ihnen so gut gefällt, ist, dass sie wirklich erzählen. Besonders der erste Geiger, Erich Höbarth, kann wunderbar unspektakulär sprechend musizieren. Man kommt heute nicht mehr an dem vorbei, was Harnoncourt uns gelehrt hat: dass die Rhetorik eine so zentrale Rolle spielt – gerade bei Haydn und Mozart, aber auch noch bei Beethoven und Brahms. Nach meiner ersten Jury-Erfahrung denke ich allerdings, es wird auch übertrieben. Da wird ein Stück mitunter vorgeführt und nicht mehr musiziert, es verliert die Natürlichkeit, man spürt zu sehr den erhobenen Zeigefinger.
Mich hat hier überrascht, wie verhältnismäßig ruppig es im forte ist. Das Tempo ist für ein Allegro con spirito entspannt, das ist typisch für die Mosaiques. Wir nehmen es etwas schneller, aber das stört mich überhaupt nicht, wenn es in sich schlüssig ist.
 Mozart: Streichquartett B-Dur KV 458 „Jagdquartett“ (Adagio)
Mozart: Streichquartett B-Dur KV 458 „Jagdquartett“ (Adagio)
Klenke Quartett 2005
Profil Edition Günter Hänssler
Das klingt wunderbar und ist sehr gut balanciert. Aber im Gegensatz zur ersten Aufnahme ist es mir etwas zu sehr in einem Tempo, da wird nicht gewartet, alles wird sofort miteinander verbunden. Das muss nichts Schlechtes sein, das ist Ansichtssache. Ich finde es sehr gut gespielt, aber mir fehlt ein bisschen der Atem. Es wird nicht viel vibriert, sehr portato gespielt, die Vorschläge sind alle kurz, deshalb kann es kein altes Quartett sein. Diesem Quartett geht es darum, etwas im Ganzen darzustellen. Erzählerisch bedeutet, dass man sich die Freiheiten nimmt zu sprechen. Dass man z.B. plötzlich ruft: Halt, jetzt kommt etwas Neues! Das gibt es hier nicht. Es ist alles abgerundet. Diese Aufnahme ist sehr gut vorbereitet. Ob das Quartett mich begeistert, wenn ich ein ganzes Programm höre, kann ich nach so kurzem Hören nicht sagen.
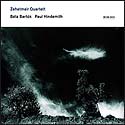 Bartók: Streichquartett Nr. 5
Bartók: Streichquartett Nr. 5
Zehetmair Quartett 2006
ECM
So wird Bartók heute fast immer gespielt – dabei bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich richtig ist. Das energetische Spiel gefällt mir gut, es ist sehr lebendig, sehr nach vorne gerichtet. Und wenn’s laut wird, auch mal richtig explosiv. Es hat diesen Bartók’schen Ernst, der aber nicht den Leidensweg von Schostakowitsch beschreibt. Bartók hat dem Quartettleben eine ganz neue Welt eröffnet. Wir haben das zweite Bartók-Quartett mit Ferenc Rados erarbeitet, der u.a. der Lehrer von András Schiff und Zoltán Kocsis war. Und er fragte uns, ob es unsere Absicht sei, „modern“ zu spielen. Für die Ungarn ist diese Musik viel muttersprachlicher verankert. Für sie ist das keine moderne Musik, diese Dissonanzen müssen nicht unbedingt wütend sein oder einen Konflikt darstellen. Die können einfach die Ohren öffnen und in einem anderen Sinne schön sein. Inzwischen klingt unser Bartók anders. Aber wir sind auch mit dieser Art des Spielens aufgewachsen: Keller Quartett, Emerson Quartett. Das gefällt mir immer noch. Aber wenn man ihn erzählerischer, mehr „parlando“ anlegt, dann, das ist unsere Erfahrung, wird er verständlicher in dem Sinne, dass man spürt: Bartók ist nicht fremd, sondern ganz natürlich aus Beethoven entstanden. Sicherlich gibt es bei Bartók starke Moment. Aber man muss hinterher nicht völlig fertig sein und alles kaputtschlagen wollen. … Das ist das Zehetmair-Quartett? Das hat etwas von alter Schule, alles ist auf den ersten Geiger ausgerichtet. Es gibt zusammengestellte Quartette, die ganz toll spielen. Vermutlich aus einer Art Euphorie heraus. Wir haben es ja selbst erlebt: Wenn jemand Neues dazustößt, tut sich eine Chance auf, da ist man erst einmal euphorisch. Es dauert eine Weile, bis man merkt, was da eigentlich passiert: dass sich das ganze Quartett verändert – und das ist nicht einfach. Wenn sich vier Leute zum Quartett zusammenfinden, gibt es diese Begeisterung für die Literatur, man probt eine Woche lang Tag und Nacht ein Programm und spielt das phantastisch. Aber wenn man länger miteinander spielen würde, würde man vermutlich Probleme bekommen. Wir waren anfangs drei Geiger, die immer die Plätze gewechselt haben. Jetzt hat jeder seinen Platz, auf dem er sich wohlfühlt. Alle sind gleichberechtigt, wir diskutieren und streiten viel bei den Proben. Aber wir sind Freunde. Wenn wir unterwegs sind, gehen wir nach dem Konzert meist zu viert essen. Wir versuchen jeden Monat mit sechs, sieben Konzerten präsent zu sein, und bereiten noch immer jedes Konzert sorgfältig vor.
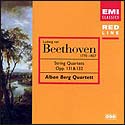 Beethoven: Streichquartett Nr. 14 op. 131
Beethoven: Streichquartett Nr. 14 op. 131
Alban Berg Quartett 1984
EMI Classics
Das ist der Klang, den das Alban Berg Quartett geprägt hat. Die könnten es sein. Das bezeichnet man inzwischen als den modernen Quartett-Klang: eine sehr helle erste Geige, sehr viel Höhen, ein bestimmter Nachhall, den es auf den alten Aufnahmen nicht gibt. Hier hört man ganz deutlich vier Stimmen mit unterschiedlicher Spielweise. Und es wird durchvibriert – ich habe das auch noch an der Hochschule gelernt, das sei eine ganz wichtige Qualität, das imitiere die Stimme. Es hat diesen „Nerv“, den Günter Pichlers Spiel immer hatte. Bei uns klingt Beethoven wohl anders. Das Alban Berg Quartett hat das Konzertleben viele Jahre geprägt. Es gehörte ja auch zu unseren Lehrern, wir haben von ihnen besonders viel über CD-Aufnahmen gelernt. Aber ihre Interpretationen waren für uns nie zwingend. Ich kann viele interpretatorische Entscheidungen sehr gut verstehen, aber mich damit nicht unbedingt identifizieren. Mein erstes Vorbild war das Vogler-Quartett, das erste Quartett, das ich seinerzeit in der DDR gehört habe. Damals hat mich begeistert, dass man die Struktur dieser unglaublichen Werke so gut wahrnehmen konnte. Und dann war ich fasziniert vom Cherubini-Quartett, von der Sinnlichkeit des Klangs, von der inspirierten Spielweise von Christoph Poppen.
 Brahms: Streichquarett Nr. 3 B-Dur op. 67
Brahms: Streichquarett Nr. 3 B-Dur op. 67
Auryn Quartett 2007
Tacet
Das ist eine ältere Aufnahme. Nein? Dann zumindest ein älteres Quartett. Mir gefällt, dass es nicht nach vorn gespielt ist, das Stück wird oft, manchmal auch von uns, zu schnell begonnen. Ich hätte mir gewünscht, dass es am Anfang leichtfüßiger gespielt wird, eher in die Mozart-Richtung, und dann im Forte etwas symphonischer. Sie spielen die Bindung sehr kurz, dadurch wird es sehr verständlich. Man hört sehr klar den 2-gegen-3-Rhythmus, vor der Schlussgruppe der Exposition klingt es sehr entspannt – daran merkt man, es ist kein junges Quartett. Und der wunderbare Rutscher in der ersten Geige zeigt, dass sie dieser alten Spieltradition verpflichtet sind. Die Aufnahmetechnik erinnert mich an 70er, 80er Jahre. Es ist schwer, ein faires Urteil zu treffen, wenn man gerade so intensiv an einem Stück arbeitet wie wir jetzt an diesem Brahms-Quartett. Wir spielen Saison-Programme, weil wir wirklich mit unserem Programm leben wollen. Wir haben vor einigen Jahren beschlossen, nicht mehr die typischen Sandwich-Programme anzubieten, und sind in zwei Richtungen gegangen: Konzeptprogramme wie „Bridges“ – Renaissance trifft Moderne – und im nächsten Jahr „Thèmes russes“: 40 Minuten am Stück mit kurzen Werken russischem Einschlags und dann ein Quartett von Tschaikowsky. Und wir wollen jedes Jahr ein großes Stück eines lebenden Komponisten spielen. Irvine Arditti hat uns da einiges empfohlen: Lachenmann zum Beispiel, der uns eine neue Welt eröffnet hat.