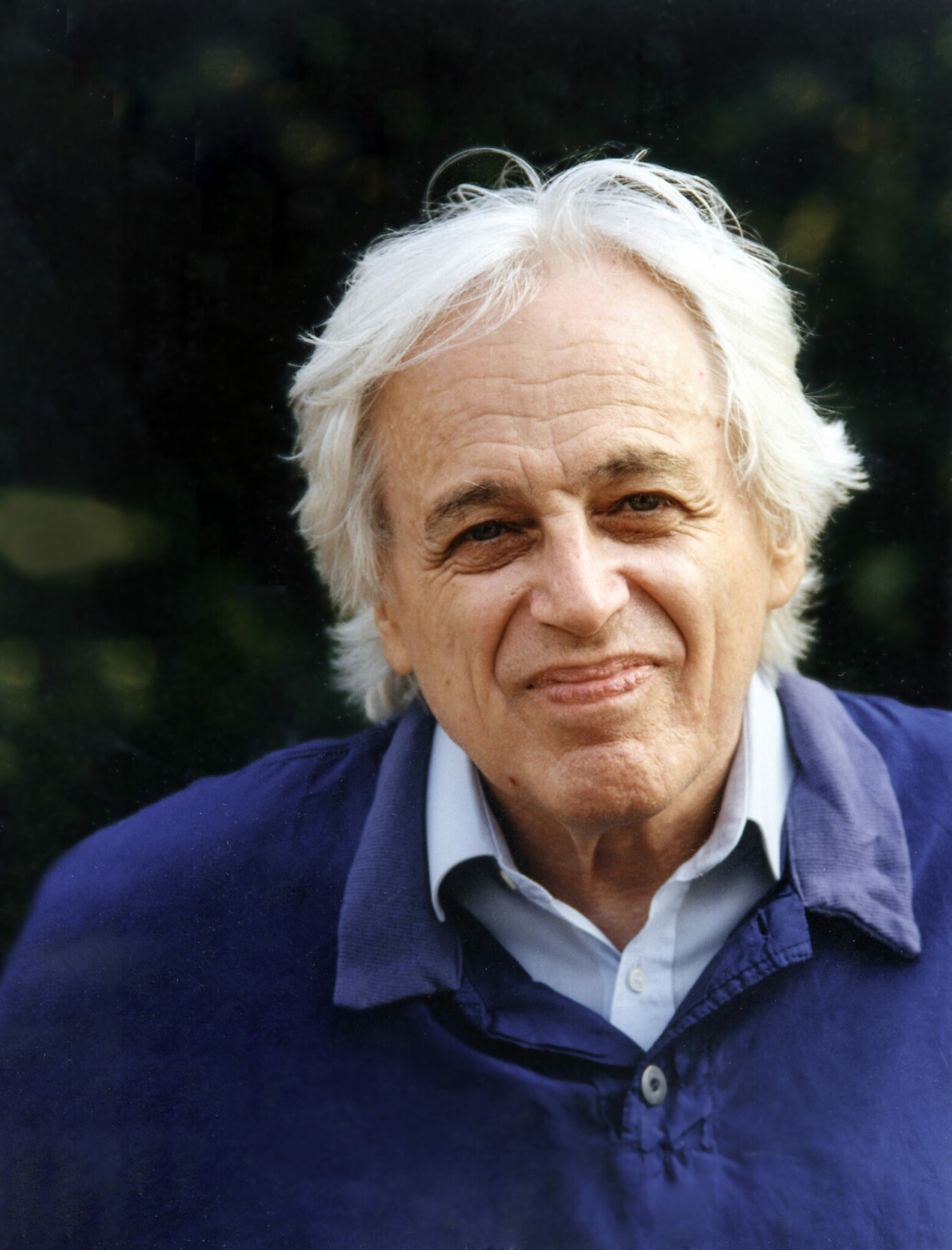Als ich Ihren Vater vor zwanzig Jahren im Interview nach seiner Musik fragte, sagte er: „Über Musik spricht man nicht. Das ist eine nonverbale Kunst.“
Lukas Ligeti: Dabei hat mein Vater detaillierte Analysen über Werke von Schubert bis zu Boulez geschrieben. Sagen wir es so: Musik ist eine nonverbale Kunst, über die man verbal kommunizieren kann.
Wie erklärt man zum Beispiel den Begriff Mikropolyfonie, eine Kompositionstechnik, die er entwickelte?
Ligeti: Das kann man durchaus in Worte fassen. Das ist eine Kompositionstechnik, in der verschiedene melodische Stränge so engmaschig miteinander kombiniert und geführt werden, dass man sie nicht mehr vereinzelt wahrnehmen kann. Mein Vater hat gerne Wollpullover getragen. Bei Vorträgen hat er dann an einem Ärmel die verschiedenen Stränge des Gewebes gezeigt, die so miteinander verwoben waren, dass man nicht mehr einzelne Fäden sah, sondern die gesamte Textur. Oder, wenn man einen Film verlangsamt, sieht man ja, dass der ganze Film aus einzelnen Standbildern besteht. In einer gewissen Geschwindigkeit gespielt, entsteht eine Bewegung.
Haben Sie diese Kompositionstechnik übernommen?
Ligeti: Ich habe sehr, sehr lange darauf geachtet, nichts zu komponieren, das ihm ähnelt. Doch in den letzten fünfzehn Jahren habe ich tatsächlich Elemente seiner Kompositionstechnik übernommen, aber nur punktuell. Zwei Werke für Kammerorchester, „Surroundedness“ von 2012 und „Curtain“ aus dem Jahr 2015, haben zum Beispiel Elemente der Mikropolyfonie, obwohl ich die Technik anders einsetze. Eines, was ich in jedem Fall von meinem Vater übernommen habe, ist Musik zu schaffen, die originell ist.
Und sie haben, wie Ihr Vater, eine starke Meinung gegen politische, kulturelle und mediale Ideologien.
Ligeti: Mein Onkel wurde in Mauthausen vergast, mein Großvater starb ebenfalls im KZ. Meine Eltern haben nicht „umsonst“ Hitler und Stalin überlebt, damit ich mich jetzt selbst zensiere oder mir einen Maulkorb auferlegen lasse.
Im Gespräch drückte Ihr Vater seine Verachtung für die Studentenbewegung der 68er um Adorno, Habermas und Bloch aus, verstand deren Verehrung für die Kommunisten nicht. Schließlich mussten er und Ihre Mutter 1956 vor der kommunistischen Diktatur in Ungarn fliehen. Sie wiederum haben sich wiederholt gegen „Identitätspolitik“ geäußert, obwohl – oder gerade weil – Sie regelmäßig mit afrikanischen Musikern zusammenarbeiten.
Ligeti: Ich war 1994 das erste Mal in Afrika – in der Elfenbeinküste im Auftrag des Goethe-Instituts – und habe mittlerweile einen Zweitwohnsitz in Johannesburg. Die interkulturelle Arbeit, die ich seit fast dreißig Jahren dort mache, ist die Erkenntnis, dass wir eine gemeinsame Welt teilen. Wir teilen einen menschlichen Zustand, ob wir aus Europa oder Afrika kommen. Ich gehe nicht als Vertreter einer „dominanten“ Kultur dorthin. Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen, setzen unsere Gedanken zusammen, experimentieren und versuchen, etwas Neues für uns alle zu erreichen. 2016 komponierte ich zum Beispiel die „Suite für Burkina Electric und Symphonieorchester“, also Musik für Orchester und einer elektronischen Popband aus Afrika, deren Mitglied ich auch bin. Da stellten sich komplizierte methodologische Fragen: Ein Orchester spielt generell nach Noten, eine afrikanische Popband aber überhaupt nicht. Wie kann man dies unter einem Hut bringen? Solche Fragen finde ich sehr spannend.
Eine Musikprofessorin britisch-indischer Herkunft an der Musikhochschule in Freiburg sagte unlängst im Bayerischen Rundfunk, sie würde nie mehr ein Programm gestalten, auf dem nur tote weiße Männer stehen.
Ligeti: Es ist für mich nur traurig, wenn Menschen andere Menschen nur danach beurteilen, wie sie aussehen und von woher sie kommen, anstatt nach der Substanz ihrer Beiträge zur Humanität.

Warum neigt die Gesellschaft derzeit wieder zu Ideologie? Ist es Angst, Unsicherheit, Rechthaberei?
Ligeti: Ein Teil ist Angst, weil es große Probleme gibt, auf die wir keine Lösung wissen. Zudem gibt es ein ideologisches Vakuum durch den Niedergang von Religionen und dem Aufkommen von neuen Technologien. Die „Woke“-Ideologien sprechen die primitivsten und ungehobeltsten Aspekte unseres Denkens an und werden deshalb leichter akzeptiert. Besonders in den akademischen Institutionen. Ich habe meine Professur in Kalifornien vor zwei Jahren aufgegeben, auch deshalb, weil die politische Polarisierung das Arbeiten schwer macht. Die „Woke“-Ideologie ist regressiv und ebenso faschistisch wie die Ideologien der extremen Rechten. Weil beide die zwei wesentlichen Merkmale des Faschismus haben: ein auf Identität basierendes, nationalistisches Denken und die Kollaboration mit dem Großkapitalismus. Die gemäßigte Linke ist uns abhandengekommen. Früher waren die Linken gegen den Kapitalismus, jetzt aber tun sie sich mit den großen Technologiefirmen zusammen, um Zensur zu betreiben. Das ist eine ganz große Tragödie, die den Zusammenhalt der Gesellschaft ernsthaft bedroht.
Zurück zu Ihrer Musik. Sie komponieren in Corona-Zeiten sogar per Whatsapp. Was hätte Ihr Vater, der in der Isolation zu Hause oder im Studio komponierte, gesagt?
Ligeti: Es hätte ihn bestimmt sehr interessiert. Kurz vor seinem hundertsten Geburtstag wurde das Ligeti-Zentrum in Hamburg an der Musikhochschule eröffnet. Mein Vater hat damals in den Siebzigern sehr gekämpft für ein solches „Research Center“ für Computermusik und konnte sich mit dieser Idee in Deutschland nicht durchsetzen. Er war seiner Zeit voraus. Als Gastprofessor in Stanford 1972 hatte er dort die Entstehung des Center for Computer Research in Music and Acoustics erlebt.
Ein „Laboratorium für Innovationen und Gesellschaftliche Entwicklung durch den Transfer von Ideen“ nennt sich das Hamburger Zentrum. Warum hat das in Deutschland so lange gedauert?
Ligeti: Die Institutionen sind oft sehr schwerfällig. Das liegt an ihrer aufgeblasenen Bürokratie, dem Mangel an Visionen oder an ideologischen Weltbildern. Konzepte werden oft nicht verstanden. Man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich bin diesmal sehr gespannt. Ich bin zwar ein Außenstehender in dieser Sache, aber natürlich freue ich mich sehr, dass dieses Zentrum errichtet und nach meinem Vater benannt wurde. Es gibt auch ein Konzert mit meiner Musik im Rahmen des kommenden Festivals zum hundertsten Geburtstag meines Vaters.
Können Sie etwas zu diesen Werken sagen?
Ligeti: Es ist Musik, in denen sich komponierte Strukturen mit Improvisationen mischen. Bei „Intermediate Vector Bosons“ etwa wird der Solist von einem weiteren mit einer Sekunde Verzögerung imitiert. In „Circuit Design“ wird ein melodisches Fragment in die Gruppe gespielt und von Musikern imitiert, mal verkürzt, mal verzögert. Ein sehr kompliziertes Unterfangen. Es geht mir um neue Denkweisen im Zusammenspiel. „La parole seule für Mezzosopran und 6 Instrumentalisten“ – Flöte, Klarinette, Violine, Cello, Klavier, Schlagzeug – von 2020 ist der Monolog einer jungen Frau, deren Vater gerade gestorben ist. Vieles am Libretto von François Emmanuel hat mich an die Zeit erinnert, als mein Vater im Sterben lag. Ich habe es damals zum Glück geschafft, rechtzeitig aus New York nach Wien zu kommen, um in seinen letzten Tagen bei ihm zu sein.
In Anlehnung an Strawinskys „I Iove my music“, sagte Ihr Vater: „I don’t love my music“. Seine Oper „Le Grand Macabre“ empfand er als Fehltritt. Koketterie oder harte Selbstkritik? Und wie ist das bei Ihnen?
Ligeti: Mein Vater war ein sehr selbstkritischer Komponist. Vieles hat er in den Mistkübel geworfen. Trotz seiner Selbstkritik war er gegen Ende seines Lebens etwas obsessiv. Insofern stimmt das mit der Koketterie. Ich bin ein methodologischer Eklektiker, riskiere sehr viel und sehe meine Musik als work in progress. Ich hoffe, dass ich immer besser werde als Komponist. Ich bin nicht so sehr verankert in der europäischen Musiktradition wie mein Vater, sondern absolut interkulturell unterwegs, und insofern gehört meine Musik ein bisschen ins Niemandsland.