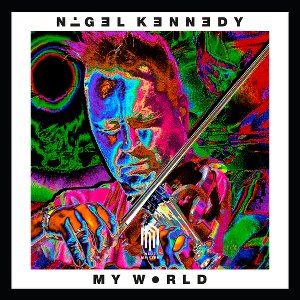Kaum ein Musiker polarisiert die Klassik-Welt so wie Nigel Kennedy. Als Geigen-Punk verschreckte er das klassische Abonnenten-Publikum und eroberte die Popcharts im Sturm – mit Vivaldi. Lustvoll sprengt der 53-jährige Brite, der bei Yehudi Menuhin und Dorothy DeLay an der New Yorker Juilliard School lernte und von Stephane Grapelli in die Kunst der Jazz-Improvisation eingeführt wurde, die Genre-Grenzen. Im November geht er mit dem Orchestra of Life auf Deutschland-Tournee, auf dem Programm stehen Vivaldi und eine eigene Komposition des Geigers. Kennedy ist mit einer Polin verheiratet und wohnt abwechselnd in Krakau und London.
Mr. Kennedy, kleine Jungs spielen Fußball, Sie haben schon als Siebenjähriger Geige gespielt. Fanden das Ihre Freunde nicht komisch?
Aber klar, Mann. Schon mit drei oder vier bin ich immer auf dem Klavier rumgeklettert. Während meine Mutter unterrichtet hat, habe ich mich unters Klavier gesetzt und mir angehört, was da oben fabriziert wurde: Chopin, Schubert und Beethoven in einem wahnsinnswarmen Klang drangen mir direkt in den Körper. Bald wollte ich selbst Klavier lernen. Da mein Vater und mein Großvater Cellisten waren, dachte meine Mutter aber, ich könnte wohl auch ein guter Streicher werden. Nun war mein Vater kurz vor meiner Geburt wieder nach Australien abgehauen, sodass Mama richtig sauer war und zu Hause kein Cello mehr hören wollte. Sie gab mir also eine Geige. Die gefiel mir erst überhaupt nicht, denn es ist schon verdammt schwierig, darauf einen schönen Klang zu machen.
Was gab den Ausschlag, dass Sie dennoch Geiger wurden?
Erst Yehudi Menuhin hat mir den Weg zu diesem verdammten Instrument gewiesen, der ja ein ganz charismatischer, offener, rücksichtsvoller und großzügiger Mensch war. Das Klavierspielen fiel mir trotzdem immer viel leichter. Da kannst du die Harmonien direkt begreifen und fühlen. Geige heißt dagegen: Du kriegst für mehr Anstrengung weniger Musik. Yehudi hat mich aber immer ermutigt, meine Individualität und Freude am Geigenspiel zu entdecken. Und allmählich machte die Geige nettere Töne, wurde immer freundlicher zu mir und schließlich doch wichtiger als das Klavier. Wenn ich aber zu Hause einfach mal nur aus Spaß Musik machen will, um zu entspannen, setze ich mich ans Klavier.
Waren Sie ein disziplinierter Student?
Oh Mann, ich war ja richtig schlimm. Ich war gar kein guter Arbeiter. Nach vierzig Minuten Üben bin ich immer aufs Klo gegangen, um da während der zweiten Unterrichtsstunde Science-Fiction-Bücher zu lesen. Mir gefiel die Überei überhaupt nicht. Dieser ganze Mist ist doch schrecklich, den du spielen musst, um erst mal deine Hände in Schwung zu bringen, bevor du dann nach Jahren mal ein Meisterwerk wie eine Solosuite von Bach in die Finger kriegst und richtig spielen kannst. Noch heute muss ich mich übrigens nach einer Stunde Probe erst mal auf dem Lokus entleeren.
In Ihren Konzerten herrscht manchmal eine Stimmung wie auf dem Fußballplatz. Was haben Musik und Fußball gemeinsam?
Natürlich hat Fußball den machtvolleren Einfluss auf die Menschen: 40.000 Leute kommen zusammen und würden sogar ihr Leben für die Mannschaft geben. So was passiert in der Musik wohl nur bei wenigen wie Led Zeppelin oder The Who. Doch auf beiden Feldern zählt letztlich das Zusammenspiel von Team und Individuum, das Gemeinschaftsgefühl und die Stimmung.
Manche Ihrer Kollegen treten ja gern in riesigen Stadien auf.
Ich hab das auch versucht, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Du merkst kaum, ob Leute da sind oder nicht, da ist mir zu wenig Atmosphäre und persönlicher Kontakt. Ich ziehe die für klassische Musik gebauten Säle vor, in die ich meinen Ton direkt und fühlbar hineingeben kann. Unter freiem Himmel geht die Hälfte der Energie flöten. Dafür können die Leute draußen andere Dinge genießen: den Blick auf ein schönes Schloss, die Abendsonne, ihr Picknick. Klar, mit solchen Outdoor gigs verdient man viel Geld, gewinnt aber keine Leute für die Schönheit guter Musik.
Für wen machen Sie eigentlich Musik?
Nicht für eine bestimmte demographische Gruppe. Mir ist vor allem wichtig, in einem gut klingenden Saal zu spielen. Und dann ist Musik doch kraftvoll genug, ganz unterschiedliche Menschen anzusprechen. Mir gefällt die Mischung in meinen Konzerten jedenfalls ganz gut. Ich würde mir allenfalls wünschen, mehr Leute aus verschiedenen Gruppen der Gesellschaft anzusprechen, zum Beispiel türkischer Herkunft.
Wie wichtig sind denn Ihr Image und das Aufbrechen von Ritualen, um andere Menschen als die üblichen Abonnenten für die Klassik zu begeistern?
Die wichtigste Regel für mich lautet, ich selbst zu sein. Ich halte mich für den einzigen Musiker ohne jedes Image. Mir gefällt es, mit dem Publikum zu sprechen und bequeme Klamotten im Konzert zu tragen. Das bin eben ich. Kollegen, die sich einen Frack anziehen, zeigen dagegen gar nichts von sich selbst. Sie erschaffen ein falsches Image, während ich gar keins habe. Ich möchte jedenfalls keine Minute meiner Lebenszeit damit verschwenden, mir Kleidung zu kaufen, sondern mache immer einen schnellen Massenkauf in einem Billigladen, bringe den ganzen Mist nach Hause und danke dann Gott, wenn alles passt.
An welchem Punkt Ihres Lebens haben Sie sich denn vom braven Jungen zum Nigel Kennedy mit Billig-T-Shirt und Springerstiefeln gewandelt?
Als ich 13 oder 14 war, hatte ich diese rebellische Phase: Wenn die Lehrer der Menuhin School mir sagten, die Haare müssten kürzer werden, wurden sie eben länger. Wenn ich Konzerte gab, schmiss ich das Jackett eben unter das verdammte Klavier und zog es erst wieder an, wenn ich hinter die Bühne ging, wo die Lehrer auf mich warteten und dann dachten, ich hätte es während des ganzen Auftritts getragen. Erst als ich so um die 19 war und mir meine Agenten sagten, ich solle mich aber jetzt mal anständig anziehen, habe ich das ein paar Jahre lang gemacht. Ich hab mich aber so unangenehm gefühlt, dass ich mir irgendwann geschworen habe, die Dinge jetzt nur noch auf meine Art zu machen.
Leben und Kunst sind für Sie eine Einheit?
Unbedingt! Ich möchte die Schönheit der Musik zunächst ganz persönlich mit meiner Jazzband und meinem Orchester und dann natürlich mit den Menschen im Saal teilen. Die gemeinsame Freude am Musizieren zählt, nicht die Arbeit. Und nach dem Konzert wird ordentlich gefeiert.
Hartes Arbeiten und Feiern schließen sich nicht aus?
Dazwischen besteht für mich überhaupt kein Widerspruch. Bevor eine Tour losgeht, wenn wir uns vorbereiten, gilt die Devise: kein Alkohol, kein Gras usw. Da bin ich total straight, bereite mich sehr diszipliniert vor. Wenn dann aber nach einem guten Konzert das Adrenalin hoch ist, musst du doch die gute Wirkung der Musik mitnehmen, Party machen, dich mit Freunden treffen, tanzen, noch eine Jam Session feiern und die Musik als Teil des Lebens begreifen.
Woran liegt es, dass Ihre Konzerte fast nie pünktlich beginnen?
Das ist wirklich schlimm. Ich habe dieses psychologische Problem, die Zeit einzuhalten, ich bin immer irgendwie eine Viertelstunde zu spät dran. Vor Konzerten hasse ich es einfach, rechtzeitig in der Halle zu sein, die Warterei auf den Auftritt macht mich total nervös. Da entspanne ich mich lieber noch in der Hotelbar, wo die Zeit viel schneller vergeht, und dann fahre ich meist zu spät zum Konzertsaal los.
Was ist wichtiger: die Schönheit des Klangs oder die Wahrheit der Musik?
Es ist nicht meine Aufgabe, einfach nur schöne Musik zu machen. Es geht um die Wahrheit der Musik. Wenn Sie den Bach von Glenn Gould hören, dann geht es um diese tiefe emotionale Erkenntnis der Musik. Die will ich auch mit meiner Guarneri entdecken. Vor allem die New York School ist verantwortlich für eine ziemlich hirnlose Interpretation von Musik, zwar technisch perfekt, aber am Thema der großen europäischen Meister wie Bach, Beethoven oder Brahms vorbei musiziert.
Auf Ihrer aktuellen Tour spielen Sie mit dem Orchestra of Life, das sie aus polnischen Musikern zusammengestellt haben. Warum ohne Dirigent? Und warum nicht mit einem renommierten Ensemble für Alte Musik?
Die direkte Kommunikation zwischen den Musikern und mir ohne den Typ mit dem weißen Stab ist mir wichtiger als technische Perfektion. Der dynamische Drive zählt. Mit den Musikern aus Polen, die über Instrumente verfügen, die nur einen Bruchteil dessen Wert sind, was ein renommiertes Orchester so in Händen hält, verbindet mich ein wirklich wunderbares, auch stilistisches Einverständnis.
Wie wird nach Ihrer Meinung die Klassikszene in zwanzig Jahren aussehen?
Meine optimistische Vision lautet, dass diese Bastardmischungen aus weichgespülter Soft-Rock-Klassik verschwunden sind, von der geldgeile Plattenfirmen behaupten, es handele sich um Klassik. Vielleicht hat sich dann statt großer Labels eine neue Struktur entwickelt, die wieder der Musik statt dem Marketing dient.