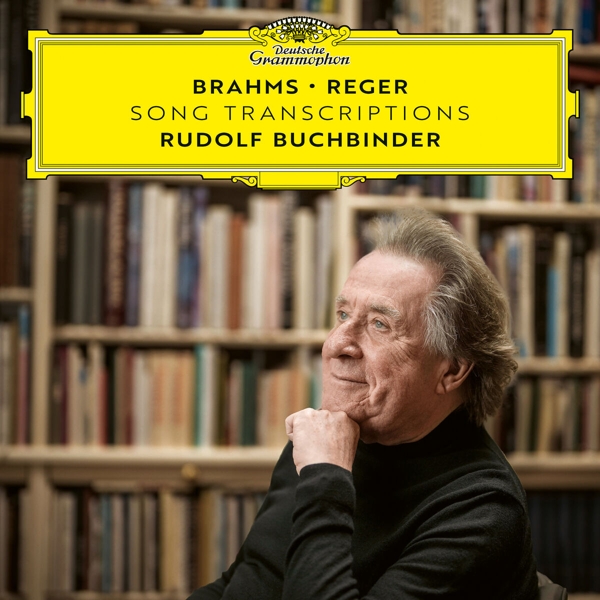Rudolf Buchbinder war jüngster Student aller Zeiten an der Musikhochschule Wien, seine Karriere begann in den 60er Jahren als Kammermusikpartner von Josef Suk und János Starker. Er pflegt ein breites Repertoire von Bach bis heute, ganz besondere Autorität aber genießt er als Interpret von Mozart, Beethoven und Brahms, kürzlich ist seine zweite Gesamteinspielung der Beethoven-Sonaten erschienen. Im Gespräch erweist sich der 65jährige als ein munterer Meister der Abschweifung.
Herr Buchbinder, Sie haben doch ein beneidenswertes Leben. Es heißt, wenn man früh anfängt und eine gute Technik hat, muss man nicht mehr viel üben. Und Beethoven können Sie doch in- und auswendig. Das heißt: Sie machen eine halbe Stunde Fingerübungen am Tag, spielen abends im Konzert Beethoven im Schlaf und widmen sich ansonsten Ihren Hobbys wie dem Malen.
Erstens spiele ich nie im Schlaf. Zweitens habe ich nie Fingerübungen gemacht. Ich habe eine sehr unorthodoxe Art zu üben. Es kann mir kein Mensch weismachen, dass man sechs Stunden am Tag konzentriert arbeiten kann. Ich übe so, wie ich ein Konzert spiele. Ich bin nach einer halben Stunde Üben kaputt und fertig – wie nach einem Konzert. Und ich übe unglaublich konzentriert, das hat den Vorteil – ich bin ja nicht mehr der Jüngste –, dass meine Technik immer besser wird. Die beiden Brahms-Konzerte fallen mir heute leichter als vor zehn, fünfzehn Jahren. Wenn ich den Beethoven-Zyklus mache, was glauben Sie, wie oft ich am Klavier sitze? Immer wieder. Da liegen alle meine Ausgaben herum, und ich entdecke immer wieder Neues.
Haben Sie wirklich 28 Ausgaben zu Hause?
32! Eine meiner letzten Errungenschaften ist die Ausgabe von Alexander Goldenweiser, Lehrer von Kabalewsky und anderen, ein ganz großer Pädagoge, Konkurrent von Neuhaus. Das ist die einzige wirkliche russische Ausgabe, alles andere sind Raubkopien. Die zu erwerben war gar nicht so einfach – ich habe sie in Petersburg bekommen, als ich meinen Beethoven-Zyklus am Mariinsky-Theater gemacht habe.
Aber arbeiten Sie wirklich mit all diesen Ausgaben? Haben Sie sich nicht längst aus den Autographen und einigen Ausgaben Ihre eigene Fassung zusammengestellt?
Es gibt ja nur von 13 Sonaten ein Autograph. Ich habe natürlich alle Faksimiles zu Hause. Von der Les Adieux gibt’s nur den ersten Satz – wo übrigens ganz deutlich mit Handschrift drüber steht: „Lebe wohl“. Les Adieux ist der größte Blödsinn. Es gibt auch einen Brief, in dem Beethoven sehr aufgebracht ist über diesen Titel. „Lebe wohl“ ist doch viel intimer.
Gewinnt man nicht doch nach so langer Beschäftigung irgendwann eine bestimmte Sichtweise?
Nein. Ich entdecke immer wieder etwas Neues. Ich will nicht meine beiden Beethoven-Aufnahmen vergleichen, aber ich bin freier geworden. Joachim Kaiser hatte mir gesagt: Du bist jetzt so frei, du musst die Sonaten nochmal aufnehmen. Es war eine Überwindung. Auf die Bühne zu gehen und zehneinhalb Stunden live aufzunehmen, ist schon eine ziemliche Belastung. Wir haben in der Semperoper aufgenommen, und kaum waren wir fertig, musste das Bühnenbild für die Abendvorstellung aufgebaut werden. Ich konnte nur jeweils vor der Sitzung am nächsten Tag eine Dreiviertelstunde lang das eine oder andere ausbessern! Aber je mehr ich mich mit der Materie und dem Menschen Beethoven befasst habe und mit den verschiedenen Ausgaben, desto freier wurde ich. Ich habe gemerkt: Wissen macht frei. Ohne etwas zu wissen, bin ich nicht imstande, frei zu sein.
Stört es Sie, wenn man Sie einen Beethoven-Interpreten nennt?
In keinster Weise. Ich spiele natürlich alle Klassiker und Romantiker, auch Bach, Zeitgenössisches, demnächst in Pittsburgh das Gershwin-Konzert, auch die Impressionisten sehr gerne. Aber Beethoven ist ein zentraler Punkt, keine Frage. Er ist für mich der mit Abstand romantischste Komponist. Es gibt keinen zweiten Komponisten der Musikgeschichte, der nach einem espressivo „a tempo“ schreibt. Zum Beispiel im opus 109, da steht zweimal nach con expressione bzw. espressivo a tempo. Was heißt das? Soll das espressivo schneller oder langsamer sein? Das steht in Ihrem Ermessen, das ist die Freiheit des Interpreten. Das „rinforzando“ ist eine Erfindung von Beethoven. Auch das ist ein emotionaler Ausbruch über eine Phrase hinweg. Beethoven schreibt das sehr oft, Brahms, der es von ihm übernommen hat, noch öfter, dann niemand mehr.
Und wovon hängt es ab, ob Sie das espressivo langsamer oder schneller nehmen?
Von der Spontanität. Wissen macht frei, aber durch das Wissen im Hinterkopf hat man auch eine gewisse Bremse, die weiß, wie weit man gehen kann, zum Beispiel mit einem rubato.
Wenn Sie auf die Bühne gehen, wissen Sie nicht genau, wie Sie etwas spielen?
Nein, mit einer strikten Festlegung auf die Bühne zu gehen, wäre für mich unmöglich. Genauso wie ich am liebsten jeden Abend etwas anderes spiele. Ich könnte nicht nur mit einem Programm reisen.
Und doch spielen Sie enorm viel Beethoven.
Im Moment ja. Ich spiele zwei Zyklen: die Konzerte von Mozart und die Sonaten von Beethoven. Die fünf Beethovenschen Konzerte kann man nicht als Zyklus bezeichnen. Und die Klaviersonaten von Mozart gehören zu den schwächeren Gesamtœuvres, die hat er für seine Studenten und als Auftragswerke geschrieben. Mozarts Konzerte gehen von KV 37 bis KV 595, die Beethoven-Sonaten von op. 2 bis op. 111. Diese Gattungen haben die beiden Menschen ein Leben lang begleitet. Und wenn Sie Beethovens Sonaten spielen, leben Sie sein Leben durch.
Dann läge es doch nahe, sie chronologisch zu spielen.
Nein! das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Es ist nicht interessant, die drei Sonaten op. 2 hintereinander zu hören. Ich mag auch die Gegenüberstellung von frühen und späten, von dramatischen und lyrischen Werken, diese Kontraste sind mir ganz wichtig. Das einzige, was ich zusammenhalte, sind die letzten drei Sonaten, die ich auch immer ohne Pause spiele. In der Pause essen die Leute Brötchen, trinken Champagner – bis sie gedanklich wieder zurück sind, ist op. 111 schon halb zu Ende. Ich spiele auch nie eine Zugabe nach der 111. Was soll man da spielen? Ein einziges Mal hab ich eine Zugabe gemacht: Alban Bergs Sonate op. 1 – das ist die logische Fortsetzung. Für das Publikum natürlich ein Schock, aber da mussten sie durch.
Wenn Sie reine Beethoven-Abende geben, haben Sie dafür eine „beste“, funktionierende Dramaturgie gefunden?
Nein, die Programme ändere ich immer wieder. Zum Glück hat er ja genug geschrieben, es gibt enorm viele Möglichkeiten der Kombination. Ich habe etwas zu meiner Regel gemacht: dass nichts eine Regel ist. Ich habe nur eine Regel: das ist der Nachmittagsschlaf vor einem Konzert. Den muss ich machen für die grauen Zellen. Es gibt Kollegen, die sagen, ich muss mich vor dem Konzert einspielen. Aber in 80 Prozent der Künstlerzimmer gibt es kein Klavier – das steht beim Dirigenten.
Wenn Sie wenig üben – arbeiten Sie denn viel ohne Klavier?
24 Stunden am Tag, sogar wenn ich schlafe. Ich wache in der Nacht auf, und sofort beginnt mein Hirn zu arbeiten. Was mich dabei am meisten ärgert, ist, dass mir nachts Stücke in den Kopf kommen, die ich gerade überhaupt nicht brauche.
Wird es mit der Zeit einfacher oder schwerer, Konzerte zu spielen?
Ich werde von Tag zu Tag nervöser. Man legt sich selbst die Latte immer höher. Die Erwartungen des Publikums zu erfüllen, ist zu wenig. Man muss sie überbieten. Man kommt in einige Städte jedes zweite Jahr. Da füllt man den Saal nicht mit Routine.
Sie haben am Anfang viel Kammermusik gemacht, jetzt nur noch selten.
Im Moment viel zu wenig, aber nächstes Jahr mache ich wieder das Dvořák-Quintett und das Forellenquintett. Kammermusik ist ganz wichtig. Man muss lernen zuzuhören, wie die Streicher phrasieren, wie die Bläser atmen. Ich sage immer: Wenn wir Pianisten zufällig richtig phrasieren, machen wir es mit dem Pedal wieder kaputt.
Fühlen Sie sich privilegiert als Wiener?
Ich bin dankbar, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin, wo man die Musik mit der Luft einatmet. Die Oper war das erste Gebäude, das man nach dem Krieg wiederaufgebaut hat. Ein Opernskandal ist in Wien wichtiger als eine Wirtschaftskrise. Man lebt mit der Musik. Nicht umsonst sind im 18. und 19. Jahrhundert so viele Musiker nach Wien gezogen. Warum? Wegen der Multikultur! Das vergessen wir heute. Erst die macht eine Stadt groß. Für Brahms war der Einfluss der Zigeunermusik oder der böhmischen Musik enorm wichtig. Was mir sehr leid tut, ist, dass Robert Schumann, der ja nach Wien wollte, dort nicht angekommen ist. Ich frage mich, was hätte dieser Mensch komponiert, wenn er in Wien gelebt hätte, unter dem Einfluss dieser Multikultur.
Warum reißt nach Ihnen die große Tradition der österreichischen Pianisten ab?
Das weiß ich nicht. Tschechien war das Land der Quartette, Amerika war voll von ungarischen Dirigenten – und plötzlich war es wieder vorbei.
Apropos: Sie haben oft vom Klavier aus dirigiert – aber nie vom Dirigentenpult.
Dazu liebe ich die schwarz-weißen Tasten viel zu sehr. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, die auf zwei Gebieten Spitze sind wie Daniel Barenboim. Wenn ich die Beethovenschen Klavierkonzerte jetzt mit den Wiener Philharmonikern vom Klavier aus leite, ist das für mich wie vergrößerte Kammermusik. Ich kenne kein Orchester, das das nicht mit großem Genuss praktiziert.
Seit 2007 sind Sie Intendant des neuen Musikfestivals Grafenegg, von dem alle, die da waren, schwärmen. Wie kam es dazu?
Ich hatte immer wieder Anfragen, aber ich bin ein Perfektionist, ich mache etwas nur, wenn ich glaube, ein Optimum erreichen zu können. Ich mag keine Kompromisse, auch wenn ich Kammermusik mache oder mit einem Dirigenten spiele – entweder man atmet die Musik gemeinsam oder nicht, darüber zu streiten ist Blödsinn. In Grafenegg kann ich verwirklichen, was ich mir vorstelle – die Crème de la Crème aufs Festival zu holen. Ich bin nicht der Typ Intendant, der nur seine Freunde engagiert. Das Publikum hat das Recht, alle zu hören. Das Programm machen die Künstler. Die spielen, was sie wollen.
Spielen Sie noch Jazz?
Das habe ich viel gemacht. Wir hatten einen eigenen Jazzkeller, und es war geplant, dass ich eine Tournee mit Oscar Peterson mache – dann kam sein Schlaganfall. Für mich ist er einer der größten Pianisten. Und ich hätte den Kürzeren gezogen. Er spielte Mozart besser als ich jazze.