Rudolf Kelber war zunächst acht Jahre Kapellmeister an den Opernhäusern in Gelsenkirchen und Heidelberg, ehe er 1982 als Kantor und Organist an die Hauptkirche St. Jacobi kam. Der aus Bayern stammende Altmeister unter den Hamburger Kirchenmusikern ist ein Mann mit breitem musikalischen Horizont und feinem Humor. So brachte er Werke von Messiaen, Elgar und Lloyd Webber zur Hamburger Erstaufführung, begleitete Stummfilme, komponierte eine Messe über Melodien von Lennon/McCartney und spielt Jazz und Tango auf der Orgel. Er unterrichtet Orgelspiel an der Hochschule für Künste Bremen.
 Bach: Jauchzet, frohlocket! aus dem Weihnachtsoratorium
Bach: Jauchzet, frohlocket! aus dem Weihnachtsoratorium
Arnold Schönberg Chor, Concentus Musicus Wien
Nikolaus Harnoncourt (Leitung) 2006
deutsche harmonia mundi/Sony
Das sind historische Instrumente, die Pauke ist zu laut. Ein kleiner Profi-Chor. Der oder die Kollegin bemüht sich um einen differenzierten Neuansatz, aber es müsste großräumiger gestaltet werden, und die Verläufe sind zum Teil gegen den Text: Bei „Verbannet die Klage“ muss man den Höhepunkt auf „Klage“ setzen, nicht auf „bannet“. Im Orchester macht jeder sein eigenes Ding, die Instrumente werden nur mit Mühe zusammengehalten. Ich würde vermuten, das ist kein ganz großer Name. Harnoncourt, wirklich? Jetzt, wo ich es weiß, würde ich sagen, das ist der Versuch, ein altbekanntes Stück neu zu durchleuchten. Da kommt man manchmal auf komische Sachen, wenn man es immer wieder anders machen will. Ich war oft in Harnoncourts Vorlesungen in Salzburg, er ist phantastisch als Dozent. Eine durchsichtige Gestaltung strebe ich für meinen Teil auch an und arbeite, wenn es das Budget zulässt, mit historischen Instrumenten, aber den Artikulationsmöglichkeiten sind in einer Kirche mit vier Sekunden Nachhallzeit Grenzen gesetzt. Man muss etwas vergröbern und darf nicht zu schnell sein. … Am Anfang meiner Tätigkeit an St. Jacobi habe ich mich gegen das jährliche Weihnachtsoratorium gewehrt. Ich habe andere Stücke gemacht, zum Beispiel Berlioz‘ L’enfance du Christ oder Saint-Saëns oder Barockes. Aber die können das Weihnachtsoratorium nicht ersetzen, die volle emotionale Portion gibt einem nur dieses Stück. Nun habe ich damit Frieden geschlossen. Ich mache aber gern zum ersten bis dritten Teil noch ein Stück dazu, das man nicht kennt, eine Kantate oder das Magnificat von Carl Philipp Emanuel Bach zum Beispiel. Bach ist natürlich das Zentrum, nur bräuchten wir mehr Motetten von ihm und weniger Kantaten. Anfang dieses Jahres habe ich eine Lukas-Passion von Bach geklont, da habe ich mich viel mit Kantaten beschäftigt, die ich noch nicht kannte, und es ist unglaublich, was da alles drinsteckt. Natürlich ist dieses orthodoxe Luthertum, das sich in den Texten niederschlägt, für uns heute schwer nachvollziehbar, aber die Musik redet von emotionalen Zuständen, die weit darüber hinausgehen. Alle Kantaten aufzuführen, schafft man unter unseren Bedingungen nicht, fast alle, die das versucht haben, sind früher oder später daran verzweifelt. Die Orgelwerke schafft man, das sind 17 Abende, das habe ich schon dreimal gemacht.
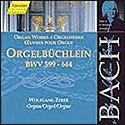 Bach: drei Stücke aus dem Orgelbüchlein
Bach: drei Stücke aus dem Orgelbüchlein
Wolfgang Zererauf der Schnitger-Orgel der Martinikerk, Groningen 1999.
Hänssler Edition Bachakademie
Das könnte die Schnitger-Orgel in Norden sein. Oder Groningen? Dann ist es der Kollege Zerer? Ich schätze ihn sehr. Generell kann man auf der Orgel weniger von sich zeigen als auf dem Klavier, aber man hat schon einige Möglichkeiten. Das wichtigste ist, dass man die „Maschine“ Orgel überwindet, dass man von einem Standpunkt aus, einem sängerischen oder bläserischen oder welchem auch immer, diese Maschine zum Singen oder Blasen bringt. Dabei helfen einem die historischen Instrumente in unnachahmlicher Weise. Mich hat die Schnitger-Orgel in St. Jacobi schon früh beschäftigt. 1955 waren meine Eltern zum Kirchentag in Hamburg und haben eine Broschüre der Orgel mitgebracht, seitdem wusste ich, dass es die gibt. Schnitger war ein sehr guter Handwerker, der technische Aufbau ist immer sehr gut, und er war ein phantasievoller Prospektzeichner. Er hat immer neue Konzepte für die jeweiligen Standorte entwickelt. Die Welt der Schnitger-Orgeln ist eine der Hochebenen, von denen man andere Hochebenen in Europa wie die Cavaillé-Coll- oder die Silbermann-Orgeln grüßen kann. Auf unserer Schnitger-Orgel kann ich noch den halben Brahms und den halben Mendelssohn spielen, alles was danach kommt, spiele ich auf unserer zweiten Orgel, die sich links daneben hinter den Säulen versteckt – zu Recht: Die Schnitger-Orgel ist die Königin, die Kemper-Orgel ist die Magd. Die macht das, wofür sich die Königin zu schade ist. Dieses Konzept wurde schon in den 60er Jahren entwickelt, wir haben vor ein paar Jahren nur den Klang etwas justiert. … Bach in St. Jacobi? Ich glaube, dass Bach 1720 vielleicht schon nach Hamburg kommen wollte, aber nicht als Organist an St. Jacobi, sondern auf den Posten, den dann Telemann bekommen hat. Als Director Musices von Hamburg hätte er nicht so viele Schulquerelen gehabt wie in Leipzig, der Hamburger Posten war schon ein bisschen attraktiver als der Leipziger. Und vielleicht hätte er dann auch eine Oper geschrieben.
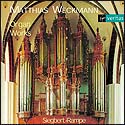 Weckmann: Toccata in d
Weckmann: Toccata in d
Siegbert Rampe an der Scherer-Orgel in St. Stephan Tangermünde 1995.
Virgin Veritas
Die Orgel ist mitteltönig und ziemlich windstößig, das gibt so einen folkloristischen, sehr lebendigen Klang. Interessantes Instrument! Das Stück ist von einem Vorgänger von mir? Weckmann! Dann kenne ich es doch, das habe ich mal auf dem Cembalo gespielt. Auch die Orgel in Tangermünde habe ich mal gespielt. Das ist ein graswurzeligeres Konzept als hier bei uns. Weckmann ist ein immer wieder verblüffender Komponist, sowohl was die kompositorische Faktur, als auch was die Instrumentierung betrifft. … Siegbert Rampe schätze ich sehr als Editor und Spieler. Heute lernt jeder Student die Grundprinzipien der historisch informierten Spielweise auf der Orgel. Aber auf einem großen Instrument in einer großen Akustik hört man davon nicht mehr so wahnsinnig viel, die Orgel hat eine Tendenz zum Nivellieren. Wenn Sie zum Beispiel diese Toccata von Weckmann auf dem Cembalo spielen, wird das erheblich persönlicher, die „Stile fantastico“-Stücke klingen auf einem verklingenden Tasteninstrument „phantastischer“ als auf der Orgel.
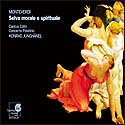 Monteverdi: Selva morale e spirituale: Dixit Dominus secondo
Monteverdi: Selva morale e spirituale: Dixit Dominus secondo
Cantus Cölln, Concerto Palatino
Konrad Junghänel (Leitung) 2000
harmonia mundi
Eine zweite Marienvesper von Monteverdi habe ich 1998 zusammengestellt, da war dieses Dixit Dominus auch dabei. Ein tolles Stück! Eine Vesper ist ein guter Rahmen, Stücke einer Stilistik gemeinsam zu präsentieren. Eine Vesper gibt einem im Gegensatz zur streng liturgischen Form der Messe mehr musikalische Entfaltungsmöglichkeiten. Die Mozart-Messen zum Beispiel können sich wegen des erzbischöflichen Zeit-Diktates gar nicht richtig entfalten. Musikalisch haben es die Protestanten besser gehabt, die haben schon immer die Autonomie der Musik mehr respektiert.
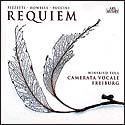 Puccini: Requiem
Puccini: Requiem
Camerata Vocale Freiburg
Winfried Toll (Leitung) 1999
Ars Musici
Ein Requiem mit einstimmigem Chor und Orgel … etwas Französisches? Jetzt kommt eine Bratsche dazu. Ist das Puccini? Ich habe mir mal die Noten angeschaut, aber ich habe es nie aufgeführt. Puccini war ja Sohn eines Kirchenmusikers, hat sich dann aber sehr weit von seinem Ausgangspunkt entfernt. Die frühe Messe ist Tschingderassabum, aber dies hier ist ganz apart. Das ist kein umkämpftes interpretatorisches Terrain, aber man hört, dass gute Amateure so ein Stück auch auf die Matte bringen.
 Messiaen: La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Messiaen: La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Koor van den BRT Brüssel, Radio Symfonie Orkest Hilversum
Reinbert de Leeuw (Leitung)
naïve
Dieses Stück hat mich bei der Erstaufführung unter Kubelik in München, als ich Student war, so beeindruckt, dass ich es immer in meinem Herzen getragen habe. Ein Stück, das sich leider nicht durchgesetzt hat. Wir haben es 2008 in der Musikhalle gemacht. Die konfessionellen Gräben haben wir glücklicherweise hinter uns gelassen. Natürlich war Messiaen ein glühender Katholik, aber sein Werk ist so überzeugend, dass es auch Leuten vom anderen Ufer möglich ist, beizupflichten. Wenn man unterrichtet, merkt man, wie die jungen Leute bei Messiaen musikalische Ur-Erlebnisse haben, wie sie ruhig werden und lernen, dass es auch Zeitdimensionen gibt, die wir uns gar nicht vorstellen können in unserer Zapping-Kultur. Messiaen öffnet ein Fenster zu kosmischen Dimensionen.

