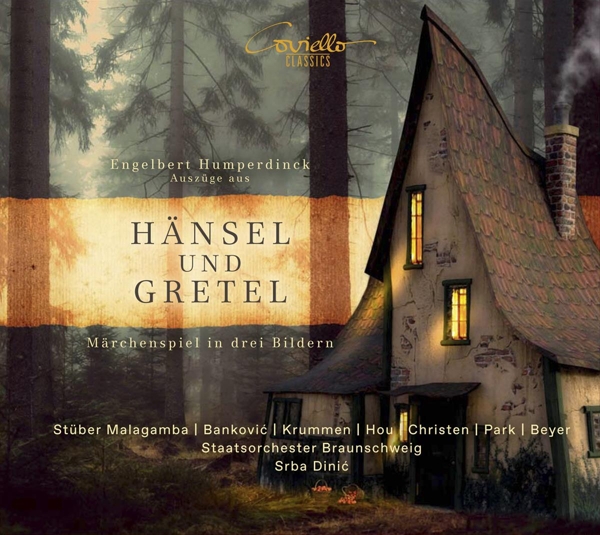Bereits im Jahr 1587 gegründet, gilt das Staatsorchester Braunschweig als eines der ältesten und traditionsreichsten Orchester der ganzen Welt. Srba Dinić war sich der besonderen historischen Verantwortung bewusst, als er 2017 sein Amt als Braunschweiger Generalmusikdirektor antrat. Angst zu scheitern hatte der stets enthusiastische, sieben Sprachen sprechende Serbe jedoch nie: Das Orchester habe ihm von Anfang an sein vollstes Vertrauen geschenkt.
Die Geschichte des Braunschweiger Orchesters reicht Jahrhunderte zurück. Hatten Sie sich im Vorfeld überlegt, wohin Sie diese Tradition führen wollen?
Srba Dinić: Man spürt, dass dieser tiefgehende, typisch deutsche Klang hier im Orchester voll verankert ist. Gerade deshalb hatte ich mir fest vorgenommen, hin und wieder auch mal eine andere Richtung einzuschlagen. Aus diesem Grund haben wir damals zum Beispiel einen großen Tschaikowsky-Zyklus gespielt. Ich komme ja ursprünglich aus Serbien, mein Großvater war auch Dirigent, und dieser slawische Klang hat mich stark geprägt. Daher freut es mich, dass wir da auch mal eine andere Farbe entwickeln konnten. Aber natürlich pflege ich auch weiterhin gerne dieses eiserne Staatsorchester-Repertoire mit Brahms, Beethoven und so weiter. Im Herzen bin ich ohnehin ein Romantiker.
Versuchen Sie, auch in altbekannte Werke Neues einzubringen?
Dinić: Neues ist immer relativ. Ich zum Beispiel bin ein großer Verehrer von Herbert von Karajan, der oft als altmodisch, old-fashioned bezeichnet wird. Aber das stimmt gar nicht, er war seiner Zeit eigentlich immer voraus. Wenn man sich italienische Opern mit Karajan anhört – ich kenne keine bessere „Bohème“ oder „Madama Butterfly“, keinen besseren „Otello“. Er hielt sich immer streng an die Partitur, das versuche ich auch ein bisschen. Ich will nicht mit Gewalt irgendwelche neuen Sachen hinzuerfinden. Natürlich spiele ich mit den Farben im Orchesterklang, mit der Begleitung, den rhythmischen Figuren, um das Stück trotzdem frisch und lebendig zu halten. Aber ich sehe mich wirklich nicht als absoluten Erneuerer. Es gibt allerdings andere Dirigenten wie zum Beispiel Teodor Currentzis, die genau das verkörpern.
Was ist ihr Credo?
Dinić: In der Regel dirigiere ich nicht einfach und das Orchester spielt, sondern ich lade das Orchester ein, mit mir etwas zu kreieren. Riccardo Muti hat das mal wunderschön gesagt, dass diese Synergie, dieser Funke vom Dirigenten auf die Seele der Musiker übergeht, dann über deren Instrumente ins Publikum springt und von dort zurückkommt zu uns auf die Bühne. In allen Orchestern sind die Musiker heutzutage hervorragend ausgebildet, viele von Ihnen stehen durchaus auf Augenhöhe mit den Dirigenten.

Gleichzeitig sind Sie – Sie haben es ja eben erwähnt – ein großer Karajan-Verehrer …
Dinić: … der quasi der Inbegriff des Alleinherrschers ist. Aber ihn, wie auch Toscanini oder Bruno Walter, bewundere ich natürlich mehr aufgrund ihres unglaubliche musikalischen Wissens und ihrer Ideen und nicht für ihren Führungsstil. Es waren andere Zeiten.
Wie erarbeiten Sie sich das Vertrauen eines Orchesters?
Dinić: Karajan sagte dazu: Ganz einfach, Sie müssen das Stück nur genauso gut kennen wie alle Musiker zusammen. Im Grunde sehe ich das genauso. Ich würde es mir beispielsweise niemals erlauben, unvorbereitet zu einer Probe zu kommen. Man muss dem Orchester beweisen, dass man eine klare Idee hat, und das am besten ohne zu langweilen, ohne viel zu erklären. Im Konzert kann man ja auch nicht reden. So entwickelt sich dann, je nachdem wie gut der Austausch funktioniert, eine ganz eigene Sprache. Ich ziehe da immer gerne den Autovergleich: Bei einem hochwertigen Sportwagen muss man das Lenkrad gar nicht viel bewegen und das Gaspedal kaum berühren, weil es so empfindlich reagiert. Und genauso verhält es sich mit guten Orchestern: Da genügen kleinste Gesten, und die Musiker setzen diese sofort um.
War Ihnen schon immer klar, dass Sie einmal einen musikalischen Beruf ergreifen werden?
Dinić: Im Grunde schon. Ich hatte schon sehr früh Klavierunterricht. Mit dreizehn Jahren allerdings hatte ich angefangen Handball zu spielen, und das auch ziemlich erfolgreich. Ich kam sogar in die junge Nationalmannschaft. Mein Vater wollte deshalb unbedingt, dass ich wie mein Onkel Sportmedizin studiere. Aber eines Tages habe ich mir gesagt: Ohne Handball kann ich, ohne Medizin kann ich auch, aber ohne Musik kann ich gar nichts. Das hat mir dann auch keiner übelgenommen.
Sind Sie heute noch sportlich aktiv?
Dinić: Wenn Sie die „Götterdämmerung“ dirigieren wollen, viereinhalb Stunden Musik, müssen Sie zwangsläufig sportlich sein! So aktiv wie früher bin ich aber leider nicht mehr, weil ich auch sehr wenig Zeit habe. Wenn, dann mache ich meist sehr ausgedehnte Spaziergänge. Ich dirigiere auch niemals im Sitzen, auch nicht bei Proben. Da läuft man immer Gefahr, zu bequem zu werden.

Sie sind auch ein sprachgewandter Literaturfreund.
Dinić: Ich kann Sprachen sehr schnell lernen. Deutsch habe ich in drei Monaten gelernt – ohne Unterricht. Und ich empfinde es als absolutes Privileg, große Literatur in ihrer Originalsprache zu lesen. Ich habe Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ zuerst auf Serbisch gelesen – und nichts verstanden. Gar nichts! Jahre später habe ich es nochmal auf Deutsch versucht. War auch nicht einfach, aber schon etwas ganz Anderes. Auch Puschkins „Eugen Onegin“ auf Russisch, Dante Alighieri auf Italienisch – man liest und versteht diese Werke einfach auf eine ganz andere Art und Weise.
Lässt sich das auch auf Musik übertragen?
Dinić: In Italien habe ich einmal „Die lustige Witwe“ auf Italienisch gemacht. Das war nicht auszuhalten! „Die verkaufte Braut“ auf Deutsch an der Semperoper ging wiederum wunderbar, aber vor allem in Rezitativen merkt man doch, dass der Rhythmus, der Duktus anders klingt als im Original. Früher waren Übersetzungen sinnvoll, damit das Publikum die Oper besser verstehen kann, aber heute gibt es technische Hilfsmittel wie Projektionen mit Unter- und Übertiteln und so weiter. Ich würde daher immer aufs Original zurückgreifen. Die Musik ist immer bewusst mit dem Wort, mit der Aussprache und der Akzentuierung verbunden. Das hört man oft sehr deutlich, vor allem auch bei Verdi oder Puccini …
… oder auch bei Wagner?
Dinić: Es gibt tatsächlich eine italienische Aufnahme von „Tristan und Isolde“ mit Maria Callas. Aber natürlich ist gerade bei Wagner die Sprache entscheidend. Vor Kurzem haben wir den „Ring“ in Braunschweig auf die Beine gestellt. Wagner richtig zu dirigieren, ohne Deutsch zu verstehen, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Auch mit den Hintergründen, mit der Mythologie, der Geschichte und Philosophie sollte man sich intensiv beschäftigen. Vielleicht nehme ich das auch besonders ernst, gerade weil ich nicht aus Deutschland komme. Ich habe letztens ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass ich wahrscheinlich überhaupt der erste serbische Dirigent bin, der den „Ring“ dirigiert hat. Das ist schon etwas Besonderes und Wunderbares. Sogar meine achtzigjährige Mutter war bei der Premiere der „Götterdämmerung“ dabei.