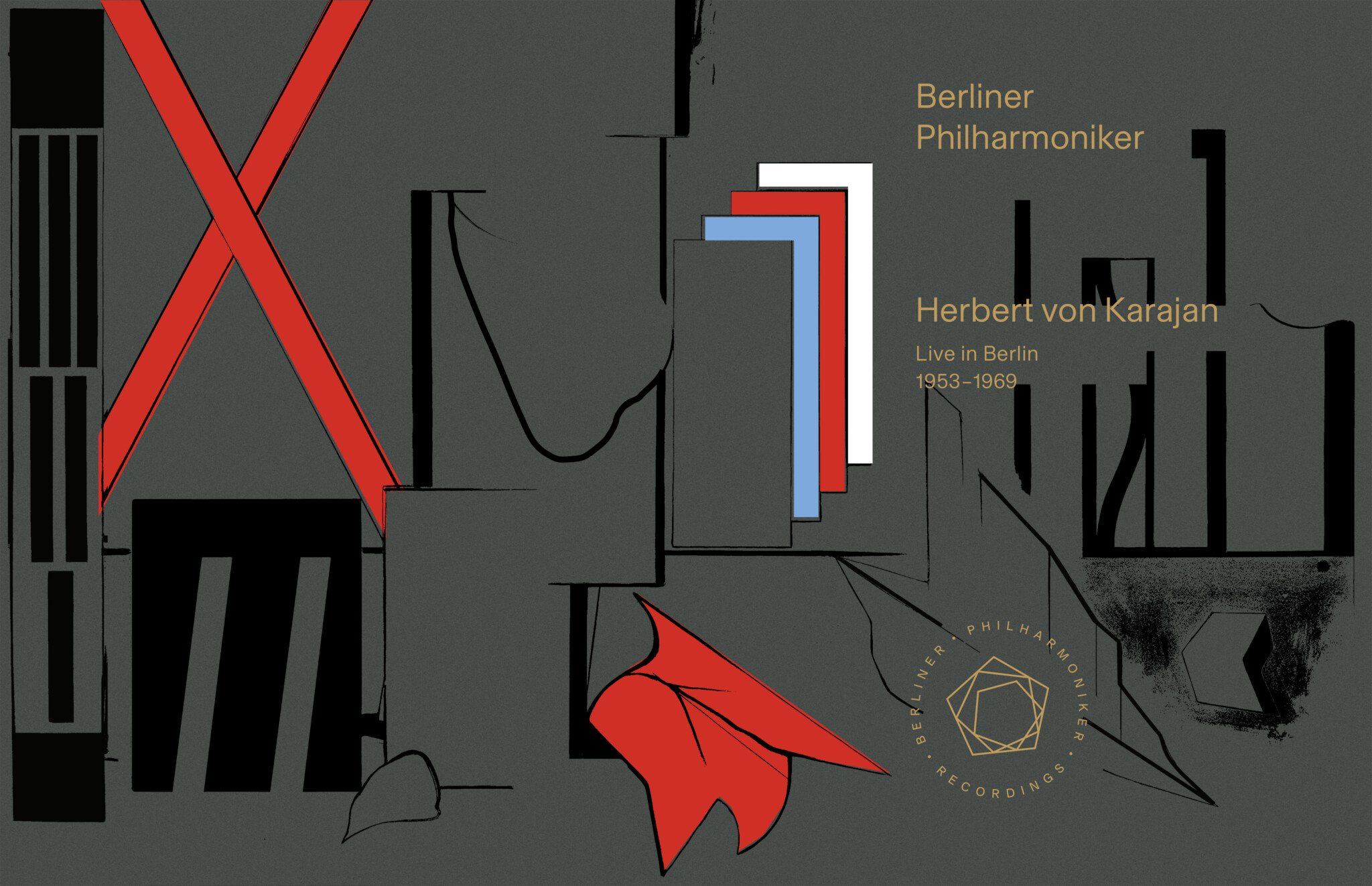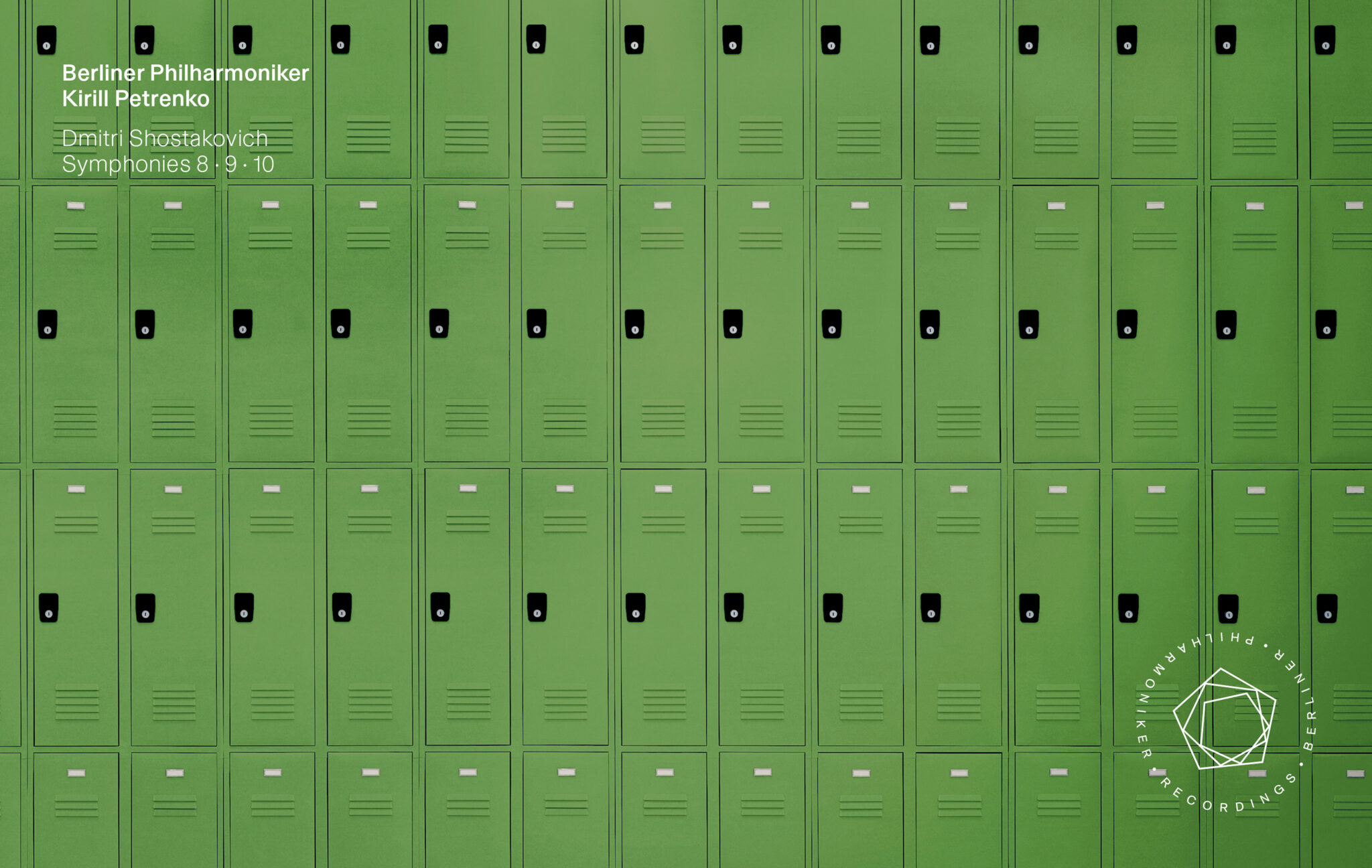Gegen Ende des zweiten Aktes von Madama Butterfly regnet es schließlich auch physische, „echte“ Kirschblütenblätter von der Decke des Festspielhauses. Ist dies ein Ausdruck von Wahrhaftigkeit – ein Kontrast zu den zuvor über die lichtstarke Videoprojektion rieselnden „falschen“ Blüten, die als wiederkehrendes Motiv die Inszenierung durchziehen? Oder ist es schlicht die wortwörtliche Umsetzung des Wunsches Cio-Cio-Sans, die in freudiger Erwartung der vergeblichen Rückkehr Pinkertons ihr Haus vorbereitet wissen möchte und daher ihre Dienerin Suzuki anweist, Blüten von Pflaumen, Veilchen, Verbenen oder eben Kirschen zu sammeln und zu verstreuen?
Seit jeher gilt die Frühlingsblüte – und ihre bewusste ästhetische Betrachtung als Hanami, die weit über Japans Grenzen hinaus Popularität erlangt hat – als Symbol des Aufbruchs und der Erneuerung oder steht eben als Topos für Vergänglichkeit und die Fragilität von Schönheit.

Elegante Inszenierung
Davide Livermore versteht es meisterhaft, für seine „Madama Butterfly“ große Bilder auf der Bühne zu entwerfen, die mitreißen, ohne zum Selbstzweck zu geraten. Was er zuletzt an der Mailänder Scala mit „Turandot“ andeutete, formulierte der italienische Regisseur in Baden-Baden nun unmissverständlich aus. Sein Ostasienbild ist weder eine bedingungslose Verklärung noch eine pauschale Ablehnung.
Statt einer neuen Interpretation durch überkritische Lesarten der ruchlosen Figur Pinkertons, wie man sie häufig gesehen hat, setzt Livermore seinem Regiekonzept eine stumme Szene voran: In einer düsteren, heruntergekommenen Gasse Nagasakis sucht der Sohn von Butterfly und Pinkerton nach der Wahrheit über seine Herkunft. Dort trifft er auf Suzuki, mit der er anhand von Bildern, Texten und Erinnerungsstücken seinen Wurzeln nachspürt.

Zwischen Erinnerung und Illusion
Der Vorhang hebt sich und gibt den Blick frei auf eine japanisierende Architektur: das Haus von Pinkerton und Butterfly – eine in sich geschlossene Welt der Erinnerungen in einem modernen Japan, das die märchenhafte Eleganz Puccinis längst verloren zu haben scheint? In dieser Kulisse entfaltet sich die altvertraute Tragödie der verlassenen, doch unerschütterlich hoffenden Cio-Cio-San.
Doch nicht allein das gesungene Drama entfaltet seine Wirkung – ebenso eindrucksvoll wirkt die allgegenwärtige Videoinstallation von D-Wok. Sie reflektiert Stimmungen und Emotionen der Figuren – etwa wenn die makellose amerikanische Flagge Risse bekommt –, und gibt zugleich Einblick in die Gedankenwelt des Sohnes, etwa durch eingeblendete kindliche Zeichnungen. Diese Bilder sind durchtränkt von Sehnsucht, Ergriffenheit und Nostalgie: Die riesigen Bildschirme zeigen den Wandel einer traditionellen japanischen Stadt hin zur modernistischen Metropole, sie zeigen Tuschezeichnungen, stürmischen Regen – oder eben einen poetischen Blütenregen.

Stimmliche Glanzlichter auf großer Bühne
Das szenische Konzept, die imposanten Impressionen und die aufwendig gestalteten Kostüme von Mariana Fracasso finden in der musikalischen Besetzung ihre ebenbürtige Entsprechung. Allen voran Jonathan Tetelman, Puccini-Spezialist mit einem wehmütig getönten Tenor, schöpft aus dem Vollen. Seine Stimme trägt jene verführerisch verlogene Karamellsüße in sich, die man dem Heldentenor allzu bereitwillig abnimmt.
Auch die Nebenrollen sind exzellent besetzt: Teresa Iervolino gestaltet die pragmatische Suzuki mit klarer Phrasierung, oft gegen die Blickrichtung des Publikums gesungen. Tassis Christoyannis verleiht dem sonst oft neutral bleibenden Konsul Sharpless durch seinen warmen Bariton die Aura eines einfühlsamen Familienvaters.

Berührende Butterfly
Eleonora Buratto setzt mit ihrer Interpretation der Titelrolle Maßstäbe. Ihre dynamische Bandbreite bleibt unerreicht, jede Szene erhält die passende Farbnuance, ihre Artikulation ist präzise bis ins Detail. Ihre Mimik ist fähig, Verzweiflung, Verachtung, innige Vorfreude und bedingungslose Liebe zum Sohn ebenso eindringlich zu vermitteln wie ihre Stimme. Höhepunkt dieser sängerischen wie darstellerischen Glanzleistung ist zweifelsohne die Arie „Un bel dì, vedremo“. Buratto gelingt es darin, eine Zukunft voller zarter Hoffnung heraufzubeschwören – eine Illusion, mit der sie nicht nur das Publikum und die Bühnenfiguren täuscht, sondern letztlich auch sich selbst – Szenenapplaus.

Klangkörper von Weltrang
Zur szenischen Opulenz gesellt sich der gewaltige Klang eines Orchesters, zu dem wohl in diesem Haus nur sie im Stande sind: die Berliner Philharmoniker. Kirill Petrenko dirigiert mit kühner Energie, treibt die dramatische Entwicklung voran, setzt auf kristallklare Luzidität und Durchschlagskraft. Und doch findet er in zentralen Momenten zu einer überraschend empfindsamen, ja fast affektierten Lesart – etwa im Intermezzo zwischen dem zweiten und dritten Akt – und erzielt damit große Wirkung.
Wie Madama Butterfly sich aus auswegloser Lage heraus dem Tod zuwendet und vom Leben Abschied nimmt, so verabschieden sich die Berliner Philharmoniker aus Baden-Baden. Nach dreizehn Jahren glanzvollen Musiktheaters kehren sie im April 2025 nach Salzburg zurück – in einer Karwoche, in der auch in der Kurstadt die Kirschblüten in einem letzten Atemzug noch einmal aufleuchten.
Osterfestspiele Baden-Baden
Puccini: Madama Butterfly
Kirill Petrenko (Leitung), Davide Livermore (Regie), D-Wok (Video), Giò Forma (Bühnenbild), Mariana Fracasso (Kostüme), Fiammetta Baldiserri (Licht), Petr Fiala (Chor), Eleonora Buratto, Jonathan Tetelman, Teresa Iervolino, Tassis Christoyannis, Didier Pieri, Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn, Berliner Philharmoniker
Termintipp
Di., 15. April 2025 18:00 Uhr
Musiktheater
Puccini: Madama Butterfly
Osterfestspiele Baden-Baden
Termintipp
So., 20. April 2025 18:00 Uhr
Musiktheater
Puccini: Madama Butterfly
Osterfestspiele Baden-Baden