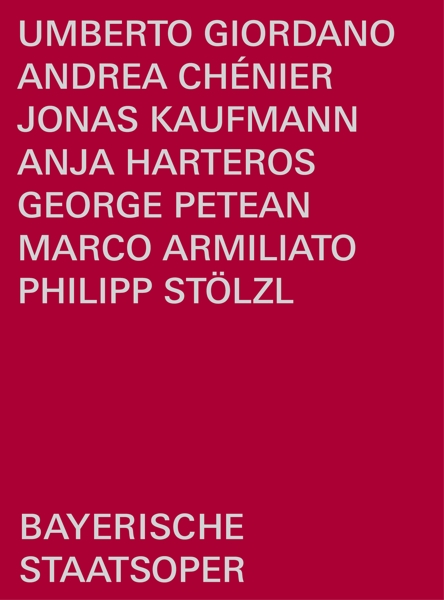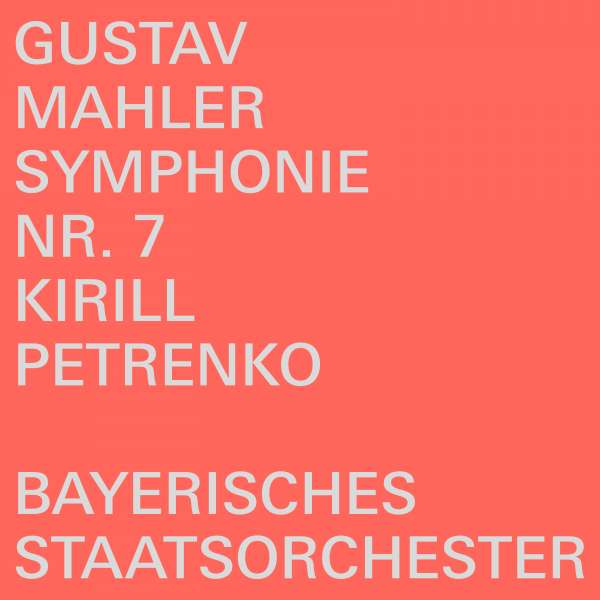Über dem Nationaltheater in München weht in diesen Tagen die ukrainische Fahne. Vor Beginn der um eine Woche verschobenen Premiere – bei der jetzt „nur“ das Regieteam aus den mittlerweile üblichen, ertesteten Gründen fehlte, und ein Solist kurzfristig ersatzweise aus Wien ausgeborgt werden musste – hielt der Münchner Intendant Serge Dorny eine kurze, angemessen ernste Ansprache. Die danach gespielte Europahymne hatte den beabsichtigten, spürbar ergreifenden Effekt im stehend lauschenden Auditorium. Dorny hatte auch daran erinnert, dass Benjamin Brittens (1913-1976) „Peter Grimes“ zum Kriegsende, am 7. Juni 1945, vor den quasi noch rauchenden Trümmern des Zweiten Weltkrieges uraufgeführt wurde. Sicher hat für den Komponisten in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die eigene, damals noch kriminalisierte Homosexualität die Sensibilität für bedrohtes Außenseitertum geschärft. Für den Komponisten muss es im postvictorianisch, spießig bigotten England gleichwohl ein ziemlicher Drahtseilakt gewesen sein, Rückschlüsse auf die eigene Biographie zu riskieren. Zumal sein Lebenspartner Peter Pears der erste Grimes auf der Bühne war.
Die gewaltbereite Masse
Wenn das in „Billy Budd“ mitschwingt oder im „Tod in Venedig“ zumindest einen Teil des Themas bildet, ist es das in „Peter Grimes“ eigentlich nicht. Das Stück beginnt sogar mit einem Freispruch und der Unschuldsvermutung, die da noch über die wabernden Gerüchte über das, was Grimes mit seinen Lehrjungen anstellt, die Oberhand behält. Das exemplarische Außenseitertum, seine Unfähigkeit zu „normalen“ Gefühlsentäußerungen, seine immer wieder aufbrechende Gewalttätigkeit gegenüber seinen Lehrjungen sind auch eine sozusagen von sich selbst ablenkende Projektion der anderen. Für die ist die Sache mit Grimes und den zu Tode gekommenen Jungs klar. Die Wortführerin ist jene Mrs. Sedley (Jennifer Johnston) die sonst vor allem mit der Nachschubbeschaffung für ihren Drogenkonsum beschäftigt ist. Selbst der nicht offen ausgesprochene Vorwurf „Kinderschänder“ funktioniert auch heute noch nahezu unabhängig von der Beweislage. Die latente und reale Bereitschaft der Masse, auf einen einzelnen loszugehen und ihn fertig zu machen, das ist bei Britten das eigentliche Thema.

Stefan Herheim will aufs Exemplarische hinaus
Vor dem Wechsel vom viel gefragten freien Regisseur zum Intendanten des Theaters an der Wien hatte der Norweger Stefan Herheim (51) an der Deutschen Oper Berlin noch „seinen“ Nibelungen-„Ring“ abgeliefert (und damit nicht nur einen Koffer in Berlin gelassen). Bevor er nach Österreich wechselt, hat er in Deutschland jetzt noch sein München- und Britten-Debüt nachgereicht. Für Herheim ist „Peter Grimes“ natürlich mehr als eine schräge Außenseiter-Geschichte in einem englischen Fischerdorf mit aufgewühlten Meereswogen und Schlechtwetterfronten aus dem Orchestergraben. Es will aufs Exemplarische hinaus. Und führt es gleichsam vor. Wie ein Theater, das sich die Menschen selbst vorspielen oder dem sie zuschauen. Mit einem Helden im Zentrum, der sich wie im falschen Film vorkommt.
Dieser Peter Grimes kämpft mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste (vor allem zu Lasten seiner Lehrjungen) für eine Lebensutopie, die er in einer gemeinsamen Zukunft mit Ellen Orford erträumt. Dem wagnergestählten und grimesversierten Tenor Stuart Skelton stehen dafür erstaunlich zarte, fast lyrische Töne zur Verfügung. Er darf sich einmal sogar auch unter einem sternenfunkelnden Firmament gleichsam aus dem Stück träumen. Da hat er eh nur wenig Fürsprecher. Die Masse weicht meistens unisono vor ihm zurück oder jagt als wutbürgerlicher Mob hinter ihm her. Um dann doch nur eine ziemlich aufgeräumte Hütte vorzufinden. Dass dieser Grimes auch sich selbst in den Lehrbuben sieht, wird klar, wenn auch er in dem angeschmuddelten weißen Anzug auftaucht, in dem der Junge unter der Obhut von Ellen Orford den Gottesdienst mit Meerblick besuchen soll. Nicht nur für die Dorfbewohner, auch für Peter Grimes ist die Wirklichkeit, die ihm entgegentritt, eine Projektion.

Herheim schafft Distanz zum imaginären Alltag der Fischer und stellt die Musik ins Zentrum
Silke Bauer hat einen Einheitsbühnenraum mit Variationen gebaut, dessen Wandelbarkeit an den Theaterzauber erinnert, mit dem Herheim in vielen seiner früheren Arbeiten gerne verblüffte. Es ist ein Gemeindesaal mit einer Bühne nebst Vorhang. Nicht nur die Höhe des Deckengewölbes ist variabel. Die Bühne auf der Bühne kann einem atmosphärischen Meerblick samt Sonnenfinsternis oder Riesenmond Platz machen. Die Seitenfenster wechseln zwischen Keller- und Kirchenfenstergröße, je nachdem in welchem Zustand sich der Raum gerade befindet. Das schafft Distanz zum imaginären Alltag der Fischer, stellt die Musik ins Zentrum und bietet vor allem dem Chor den Raum, um sich als eigenständiger Akteur zu bewegen. Die Choristen werden immer wieder von eskalierenden musikalischen Unwettern von der Seite in diesen Raum regelrecht hineingeweht. Diese aus der Musik abgeleiteten Aktionen sichern zumindest anfangs Aufmerksamkeit, vermögen es aber nicht, die Spannung bis zum Ende hin zu halten. Für einen Moment zieht die noch einmal an: Nachdem der sich mitunter fast bis zum Doppelgänger einfühlende Captain Balstrode (stimmlich und darstellerisch hochpräsent: Iain Paterson) seinen Freund Grimes den Selbstmord auf hoher See als Ausweg gewiesen hat, will Ellen Orford einen Moment lang von der Klippe (sprich dem Souffleurkasten) springen, wird aber davon abgehalten. So recht zwingend wirkte das bei der durchweg in sich ruhenden, selbstbewusst agierenden Rachel Willis-Sørensen zwar nicht. Es krönte aber ihr stimmlich höchst überzeugendes Rollenporträt.

Fein ausziselierter, farbenreicher Britten-Klang
Die Musik Brittens kommt unter der Leitung von Edward Gardner am Pult des Bayerischen Staatsorchesters an diesem Abend voll zu ihrem Recht. Das gilt für die mit feiner Transparenz begleiteten Parlandopassagen bis hin zu den geballten Chor-Crescendi. Zur düsteren Geschichte verströmt das Orchester jedenfalls fein ausziselierten, farbenreichen Klang. Das Publikum applaudierte herzlich – und hätte vermutlich auch das Regieteam eingeschlossen. Die Kontroverse, die szenische Geniestreiche oder handwerkliche Defizite auslösen, die wäre ihm jedenfalls in beiden Fällen erspart geblieben.
Bayerische Staatsoper München
Britten: Peter Grimes
Edward Gardner (Leitung), Stefan Herheim (Regie), Silke Bauer (Bühne), Esther Bialas (Kostüme), Michael Bauer (Licht), Michael Bauer (Licht), Torge Møller (Video), Malte Krasting & Alexander Meier-Dörzenbach (Dramaturgie), Stellario Fagone (Choreinstudierung), Stuart Skelton, Rachel Willis-Sørensen, Iain Paterson, Claudia Mahnke, Lindsay Ohse, Emily Pogorelc, Bob Boles, Thomas Ebenstein, Brindley Sherratt, Jennifer Johnston, Robert Murray, Konstantin Krimmel, Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staatsorchester