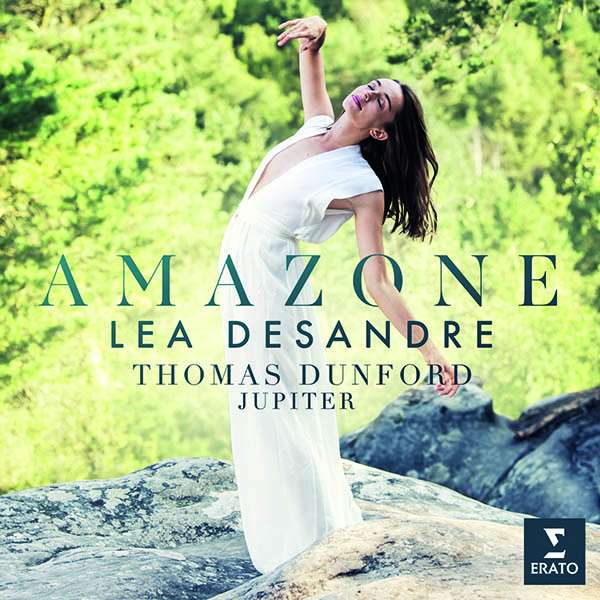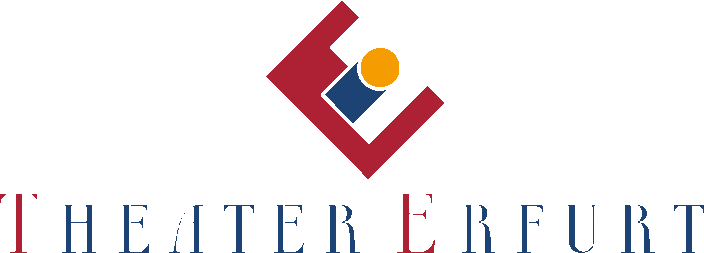Das verschmitzte Lächeln eines kleinen Jungen hat er sich erhalten – und doch gehört Thomas Dunford zu den ernsthaftesten und zugleich experimentierfreudigsten Musikern seiner Generation. Ein wenig wirkt das umfangreiche Repertoire des Lautenisten wie eine Flucht nach vorn, denn obwohl die Barockliteratur für das schon von seinen Bauformen her so vielfältige Zupfinstrument so groß ist wie kaum für ein anderes, endet sie eben auch spätestens im 19. Jahrhundert. Oder doch nicht? Der Franko-Amerikaner arbeitet seit Langem sowohl mit diversen anderen Alte-Musik-Solisten und Originalklang-Ensembles als auch mit zeitgenössischen Komponisten und Jazzmusikern zusammen. Wie ein Besessener schreibt er selbst neu, arrangiert und anverwandelt Musik jedweden Genres für sein Instrument.
„Die Musik hat für mich entschieden“
Aber wieso ausgerechnet die Laute? „Ich komme aus einer Musikerfamilie, wir wuchsen von Anfang an mit Barockmusik auf“, erzählt der heute 33-Jährige, der sein Instrument als Neunjähriger in einem Workshop mit seiner Schwester kennenlernte. „Das Schöne ist, dass die Finger direkten Kontakt zum Instrument haben, anders als beim Cembalo. Als Kind erlebt man diesen Zauber spielerisch, und der hat mich nicht mehr losgelassen.“ Vor allem die vielfältigen Improvisationsmöglichkeiten weckten in ihm die Entdeckerfreude, „und obwohl ich nie geplant habe, Musiker zu werden, kam mein Instrument einfach zu mir, die Musik hat für mich entschieden.“
Mit 21 schloss Dunford sein Studium am Conservatoire de Paris ab, brachte 2012 seine erste CD heraus und gewann ein Jahr später den renommierten Caecilia Preis. Die Entdeckung des „Eric Clapton der Laute“, wie das BBC Music Magazine ihn taufte, hatte begonnen. Möglicherweise auch eine Mode. „Das Publikum liebt Emotionen, und die Laute erzeugt ganze Universen, durch die das Publikum wandeln kann, mit ihren Farben, ihrem Klang, ihren Kontrasten“, bewundert Thomas Dunford. „Vor zehn Jahren hätten viele Leute noch gefragt, was das für ein Instrument sei.“ Heute dagegen komme die Laute durch ihre große Stille dem wachsenden Wunsch zur Kontemplation entgegen. „Mit ihr kann man die wunderschöne Einfachheit des Klangs erleben, und dann wieder kann sie groß und laut sein.“ Diese Schwärmerei mutet fast schon menschlich an, und Thomas Dunford vergleicht sein Instrument gar mit einer „schönen Frau – zugleich stark und elegant, smart und charismatisch“. Als Partner sieht er sie dennoch nicht, „mehr als Stimme meiner Seele, wir sind dasselbe: Sie aus Holz, ich aus Fleisch, und zusammen machen wir Musik“.

Thomas Dunford: Legendäre Liveauftritte
Dass dem so ist, hört man zwar auch bei den hochgelobten CDs, die der Lautenist weiterhin aufnimmt, „obwohl diese unrealistischen Collagen der perfekten Aufführung eigentlich die notwendige Spontaneität der Musik beschädigen“. Was da produziert werde, sei im Grunde nichts weiter als eine Illusion. Dagegen sind Dunfords Liveauftritte legendär, weil sie durch seine schiere Reaktions- und Improvisationsfreude auf jedes Publikum einen besonderen Reiz ausüben.
Vielleicht ist einfach die Zeit gekommen für die leiseren Töne, das Auftrumpfen der Innigkeit? Anders als Trompete, Flöte, Harfe oder Schlagwerk überlebte die 4.000 Jahre alte Laute im Europa das 18. Jahrhundert nach ihrer kunstmusikalischen Verdrängung durch Gitarre und Klavier nicht. Dabei retteten ihre internationalen Verwandten ihre jahrtausendalte folkloristische Tradition bis heute auch in die letzten Erdenwinkel. Erst in den letzten Jahrzehnten erobert zumindest die Barocklaute auch hierzulande wieder die klassischen Konzertbühnen – und nicht nur die: Thomas Dunford jedenfalls stürmt je nach Programm berühmte Säle und Festivals genauso wie angesagte Discos und intime Musikkammern. „Je mehr Ensembles und Sichtweisen man kennenlernt, desto weiter wird der Horizont.“
Da überrascht es kaum, dass er zwischen den Genres kaum Grenzen zieht, „wie sie von der Gesellschaft konstruiert werden“. Neue Formen der Musikkreation könnten so „das verkrustete Konzertleben aufbrechen“, meint der Allround-Lautenist. Selbst zwischen Jazz und Bach gebe es gar nicht so viele Unterschiede: „Natürlich sind Sprache und Vokabular verschieden, aber die Essenz ist die harmonische und rhythmische Grammatik, die beidem zugrunde liegt.“ Und natürlich die Lust an der Improvisation. „Jeder Komponist ist einzigartig, wir pappen dann nur ein Etikett drauf. Aber all das ist am Ende Musik.“