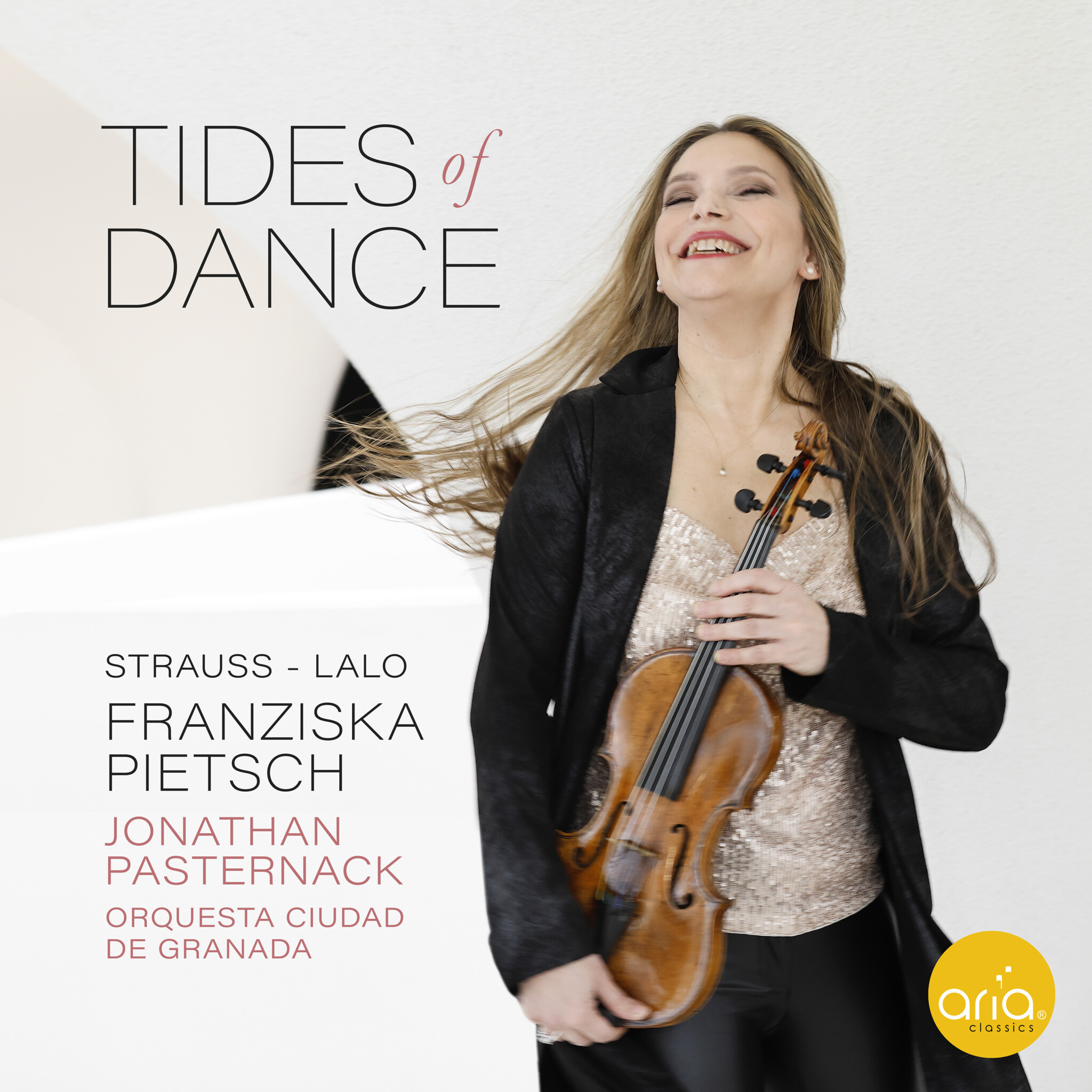Gerald Mertens, Jahrgang 1959, studierte Rechtswissenschaften und Kirchenmusik. Der Hobbyflötist wurde 1990 als juristischer Mitarbeiter bei der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) eingestellt und bearbeitete dort von Anfang an sein Kernthema des kulturellen Strukturwandels in Ostdeutschland. Seit 2001 ist er Geschäftsführer der DOV. Im Interview umreißt Mertens die Herausforderungen der Einheit für die Musiklandschaft in Ost und West.
Haben Sie noch das letzte Musikensemblebuch der DDR von 1989?
Gerald Mertens: Ja, da staunt man nur, was dort mal existiert hat. Gesamtdeutsch zu zählen begonnen haben wir erst 1992. Von den damals 168 Berufsorchestern sind heute noch 129 übriggeblieben, und da sind kleinere Ensembles wie das Orchester der Volksbühne, des Deutschen Theaters oder des Berliner Ensembles gar nicht mitgezählt. Die waren so schnell weg, dass man sie gar nicht zählen konnte. Man muss sich mal vorstellen, dass etwa Schwerin mal drei Orchester hatte: die Philharmonie, die Staatskapelle und ein Jazzorchester. Heute gibt es nur noch eins.
Was begründet nach Ihrer Beobachtung diesen eklatanten Schwund?
Mertens: Nach dem Zusammenbruch der DDR hatte das große Kultursterben, das ja bei weitem nicht nur die Orchester betraf, ganz verschiedene Ursachen, wesentlich dabei die Umstrukturierung der Landes- und Kommunalverwaltungen. War im Westen die Kulturfinanzierung Sache der Länder und Kommunen, hatte sie sich in der DDR vor allem auf die Bezirke und Kreise gestützt. Allein durch die Auflösung der 16 Bezirke und die anschließenden Kreis- und Gebietsreformen hatten die neuen Verwaltungen alles Mögliche im Blick, vor allem den wirtschaftlichen und sozialen Wandel, aber nicht die Kultur.
Artikel 35 des Einigungsvertrages sah ja vor, dass „die kulturelle Substanz keinen Schaden nehmen“ sollte.
Mertens: Daraus begründete sich eine Übergangsfinanzierung des Bundes, die aber 1994 halbiert wurde und danach auslief. Zur gleichen Zeit erlangten in Ostdeutschland auch die westdeutschen Abfindungsregelungen des damaligen „Tarifvertrages für Kulturorchester“ (TVK) Gültigkeit, so dass noch kurz vorher eine große Schließungswelle übers Land schwappte, um den hohen Zahlungen zu entgehen. Danach flachte die Kurve ab bis in die 2000er Jahre hinein.
Aber die Nachfrage brach ja auch entscheidend ein.
Mertens: Wobei der Bevölkerungsschwund sich erst in den neunziger Jahren bemerkbar machte. Wesentlich beeinflusst wurde die geringere Nachfrage, weil betriebseigene Anrechtssysteme mit den sie tragenden Volkseigenen Betrieben (VEB) zusammenbrachen. Klar ist auch, dass zu DDR-Zeiten vielleicht verordnete, aber doch wahrgenommene Kulturangebote auch auf dem platten Land existiert hatten. In der DDR galten Sport und Kultur als Exportschlager und Aushängeschilder. Diese Art von Arbeiterkultur war im Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verpönt.
Und wer plötzlich arbeitslos ist, geht vielleicht nicht zuerst ins Konzert.
Mertens: Natürlich überlege ich mir bei existenziellen Alltagssorgen zweimal, ob ich meine Kulturnutzung so weiterführen kann wie bisher. Und je stärker ein Standort von Industrie geprägt war, die dann abgewickelt wurde, desto problematischer war es danach. Im Braunkohlerevier von Senftenberg, wo es ursprünglich sogar mal zwei Orchester gab, existiert heute nur noch ein minimales Schauspiel. Dort gab es Kultur, weil es Arbeiter gab, die unterhalten werden sollten. Als der Chemnitzer Uranbergbau Wismut pleiteging, starb auch das quasi werkseigene Staatliche Sinfonieorchester.
Da scheinen die etablierten, traditionsreichen Häuser besser durch die Krise gekommen zu sein.
Mertens: Auf jeden Fall. Man muss dazu wissen, dass die kleineren teilweise Häuser schon zum Ende der DDR auf dem letzten Loch pfiffen, weil sie seit Anfang der achtziger Jahre ihren Personalbestand nur noch mit Musikern aus den befreundeten Ländern Osteuropas auffüllen konnten. So waren zum Beispiel im Konzertorchester Thale viele Musiker aus Bulgarien und Rumänien eingestellt, weil die hiesigen Hochschulen zu wenige Absolventen produzierten. Mit der Wiedervereinigung brach dieses ganze System natürlich zusammen.
Wie beurteilen Sie heute die Situation?
Mertens: Für die Publikumsentwicklung gibt es im Osten nach wie vor große Defizite in Musikvermittlung und kultureller Bildung. Heutzutage sind die Teilnehmerzahlen von Education-Programmen im Westen deutlich höher als im Osten. Mitteldeutschland zum Beispiel hat eine vergleichsweise hohe Orchester- und Theaterdichte, die teilweise mit noch immer deutlich niedrigeren Löhnen oder Gehaltsverzicht erkauft wird. Aber Marketing und Vermittlung halten mit der modernen Entwicklung oft nicht Schritt. Zum Teil heißen Abonnementsysteme immer noch Anrecht wie 1950. Da geht noch mehr, vor allem vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund, dass es notwendig ist, zumindest an einigen Standorten das bürgerliche Kulturbewusstsein stärker weiterzuentwickeln.
Ermüdet es Sie nicht, immer vom Untergang der Kultur sprechen zu müssen?
Mertens: Diese Bergab-Prosa haben wir längst aufgegeben, weil sie völlig kontraproduktiv ist. Stattdessen werben wir seit Jahren positiv dafür, dass es sich lohnt, für Kultur als wesentlichen Quell von Lebensqualität vor Ort öffentliches Geld auszugeben.
Noch vor Corona sind die Besucherzahlen fast überall gestiegen und die Lage der Orchester schien weitgehend gesichert.
Mertens: In der Tat waren noch Anfang 2020 alle Indikatoren überaus positiv. Dann kam Corona. Stabile Strukturen und gesicherte Arbeitsverhältnisse in den Orchestern sorgten in letzter Zeit für substanzielle Verbesserungen in West wie Ost. Man kann heute von einer Konsolidierung auch für kleinere Institutionen sprechen. Hier muss man nicht mehr dauernd Angst haben, dass ein Orchester demnächst wieder fusioniert oder geschlossen wird, zumal alles, was halbwegs in der Nähe lag, schon zusammengezwungen wurde. Im Nordosten Mecklenburgs haben auch Bürgerproteste dafür gesorgt, dass die wahnwitzige Idee, zwei in den neunziger Jahren schon mal fusionierte Theater und Orchester noch einmal zu einem „Staatstheater Nordost“ zu fusionieren, Ende 2017 aufgegeben werden musste. Ich hoffe nur, dass Corona nicht zu tiefe Dellen schlägt und die spürbare Sehnsucht des Publikums für die Musik erhalten bleibt.