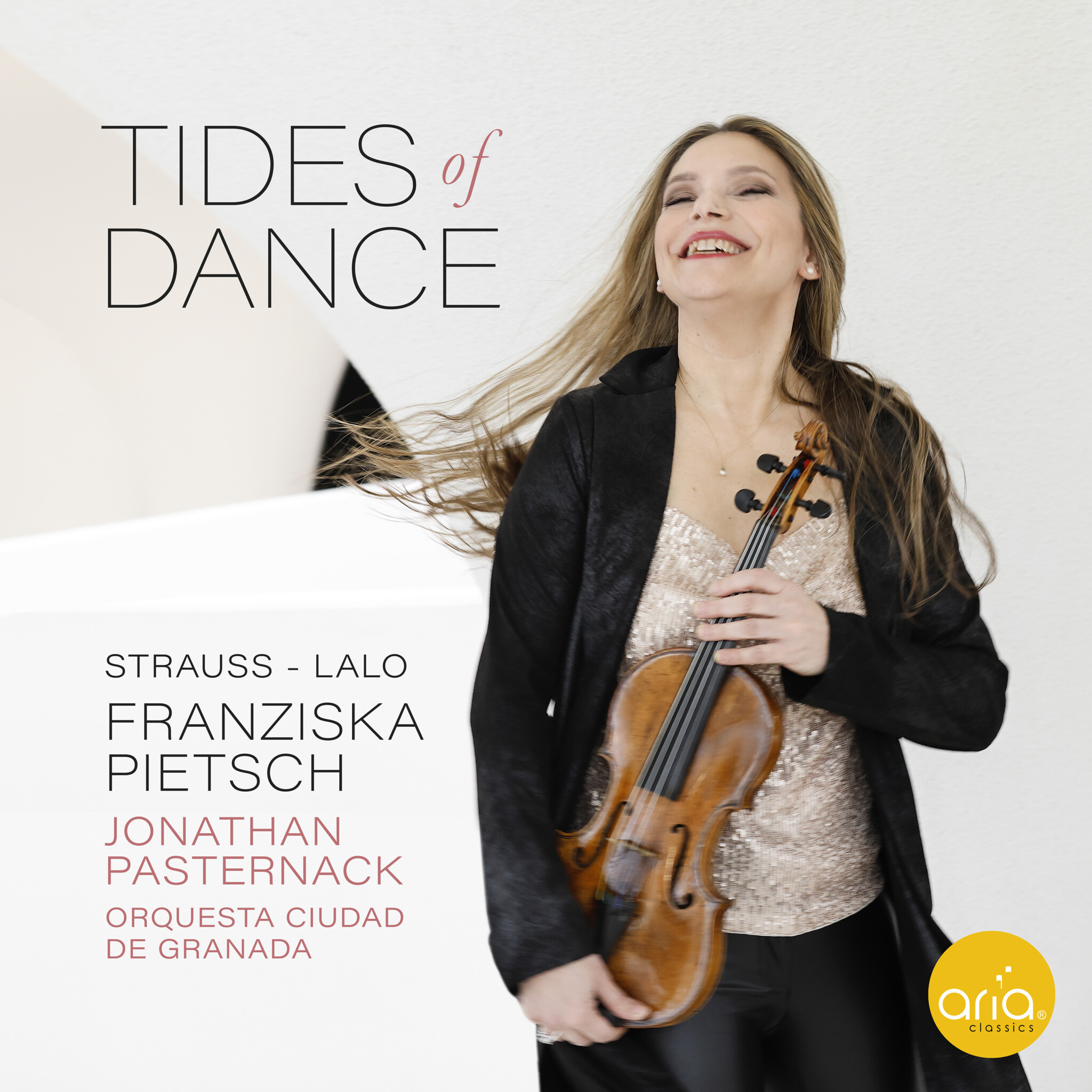Eckart Kröplin, 76, kennt wie kaum ein Zweiter die Kulturlandschaft der ehemaligen DDR. Zunächst Lektor bei Breitkopf & Härtel in Leipzig, wurde der Musikwissenschaftler 1978 an der Leipziger Universität habilitiert. Seine Forschungsschwerpunkte waren insbesondere Richard Wagner und die Komponisten der frühen Sowjetunion. Ab 1984 wurde er Chefdramaturg an der neueröffneten Dresdner Semperoper und weiteren Theatern in Sachsen und Thüringen. Im Herbst erscheint im Henschel Verlag sein neuestes Buch „Operntheater in der DDR“. Im Interview ergründet Kröplin den Wandel der Kulturlandschaft nach 1990.
Worin liegt der kulturelle Reichtum vor allem in Mitteldeutschland begründet?
Eckart Kröplin: Auf dem Boden der späteren DDR waren viele kleine Fürstentümer mit eigenem kulturellem Leben beheimatet gewesen. Der kleine, arme Staat DDR, völkerrechtlich kaum anerkannt, war darauf bedacht, sich durch seine ererbte Kultur zu präsentieren. Man brauchte ein Aushängeschild. Zum Beispiel nahm die Neugründung der Berliner Staatsoper 1955 für sich bewusst in Anspruch, den deutschen Staat insgesamt zu repräsentieren, im Ergebnis tobte lange Jahre ein Opernkrieg in Berlin, der 1961 zur Eröffnung der Deutschen Oper in Charlottenburg führte.
Aber es gab auch bewusste Neugründungen.
Kröplin: Die Volksbühnenbewegung der fünfziger Jahre, das Anrechtssystem der Volkseigenen Betriebe oder auch die „Stunden der Musik“ bis in die kleinsten Dörfer hinein waren Ausdruck des Anspruchs, Kultur für alle anzubieten ohne sozialen Dünkel. Allein in den kleineren Städten wurden zwanzig „Staatliche Sinfonieorchester“ neu gegründet, etwa in Saalfeld oder Frankfurt (Oder). Der Zweck dieser Breitenkultur war, allen eine möglichst umfassende Bildung zu verschaffen. Damit war der Bruch nach 1990 nicht nur finanziell, sondern auch ideologisch begründet. Heute muss man sich sehr anstrengen, abseits der urbanen Zentren überhaupt an Kultur zu kommen – ökonomisch wohl verständlich, aber auch bedauerlich.
Wie wurden vierzig Jahre Kulturentwicklung im Nachhinein betrachtet?
Kröplin: Die Nachwendekritik an der DDR-Kultur war wie in anderen Bereichen ziemlich pauschal. Tatsache ist, dass die DDR ihr ganzes Leben lang begleitet wurde von immensen Widersprüchen zwischen Kunst als doppelter Realität im Sinne Brechts und den Forderungen des sozialistischen Realismus, der zwar im Humanismus des 19. Jahrhunderts gründete, aber ästhetisch-ideologisch völlig eingeengt war. Umso eigenständiger die Kunst, desto mehr Widerstand war auch möglich. Literatur und Malerei werden seit einigen Jahren im Rahmen einer Art Rehabilitation wieder thematisiert, aber das Musiktheater entdeckt erst in jüngster Zeit wieder einige Werke bekannter DDR-Komponisten. Niemand möchte die DDR-Kultur wiederbeleben, aber es gilt, sich ihrer möglichst objektiv zu erinnern.
Hat sich nicht manches auch in die neue Zeit hinübergerettet?
Kröplin: Des Überlebens wert ist auf jeden Fall der zugewandte Humanismus, der immer nach dem Menschlichen und Heutigen zu fragen bemüht war. Im Sinne Walter Felsensteins haben sich Harry Kupfer, Ruth Berghaus oder Peter Konwitschny in ihrer Art der Annäherung an ein Werk seit DDR-Zeiten eigentlich nicht verändert. Das trifft übrigens auch auf die Unterhaltungsmusik zu, etwa bei den Puhdys oder Karat.
Kann man überhaupt nach 1990 von einer wiedervereinigten Kultur sprechen?
Kröplin: Eine Annäherung der beiden deutschen Staaten auf dem Gebiet der Kultur hat es ja schon weit vorher auf der persönlichen Ebene gegeben, aber auch institutionell durch Koproduktionen, grenzüberschreitende Rezensionen oder reisende Künstler von hüben wie drüben. Durch die durchaus mögliche Abhebung von ideologischen Forderungen war die Musikszene im Osten derjenigen im Westen absolut gleichwertig. DDR-Komponisten wie Siegfried Matthus oder Udo Zimmermann haben nahtlos unter neuen Vorzeichen weitergearbeitet, ohne sich völlig umdrehen zu müssen. Die ästhetische Wiedervereinigung war also nicht das große Problem, aber organisatorisch bedeuteten die letzten dreißig Jahre natürlich einen schmerzhaften Kahlschlag, teilweise auch im Westen.
Aber es gibt noch viele Angebote zumindest in den urbanen Zentren.
Kröplin: Ich fürchte, der Trend der Schließungen aus den neunziger Jahren ist bei kleineren Theatern und Kultureinrichtungen auf dem Lande noch nicht abgeschlossen. Grenzen der Fusionsfähigkeit hat man nicht nur in Rudolstadt und Eisenach gesehen. Viele derartige Kooperationen sind heute Zweckehen ohne viel Gegenliebe. Und wo noch ein Angebot besteht, ist im Gegensatz zum damaligen Anrecht ein Abonnement heute eine teure Unternehmung und für eine Postsekretärin nicht mehr erschwinglich, die sich das früher leisten wollte. Man muss befürchten, dass die öffentliche Kulturfinanzierung dann in Frage gestellt werden wird, wenn die heute junge Generation alt ist. Ich wage da keine Prognose.
Aber gibt es nicht auch positive Beispiele?
Kröplin: Unbedingt! Der Dresdner Kammerchor zum Beispiel, 1985 von Hans Christoph Rademann gegründet, ist heute ein führender Kammerchor europaweit, aber eben eine persönliche Initiative mit bescheidener öffentlicher Förderung. Trotz dieser Reprivatisierung des Kultursektors lässt das hoffen. Was aber an staatlich institutionalisierter Kultur verloren geht, kommt nicht wieder.