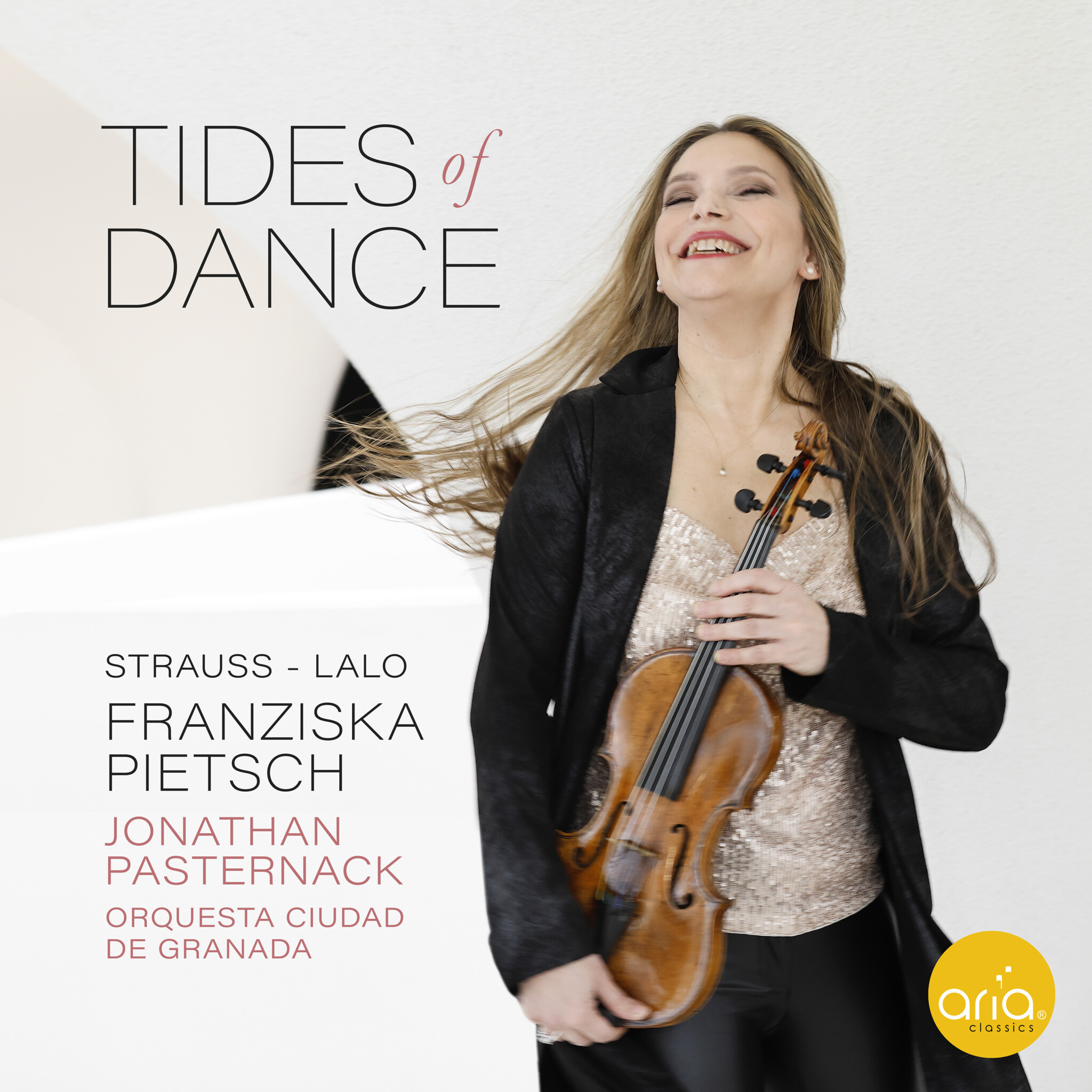Ekkehard Klemm, Jahrgang 1958, begann seine künstlerische Karriere als Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Nach seinem Dirigierstudium in Dresden trat er die Stelle des 1. Kapellmeisters am Landestheater Altenburg an und war zur Wendezeit Chefdirigent in Greifswald. 1996 wechselte er an das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz. Sieben Jahre später folgte er dem Ruf an die Dresdner Musikhochschule als Dirigierprofessor. Dort war er fünf Jahre lang deren Rektor. Seit 2017 ist er Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen, die 1945 als „Stadtorchester Riesa“ gegründet und seit 1990 mehrfach fusioniert wurde, zuletzt mit dem Orchester der Landesbühnen Radebeul. Im Interview spricht Klemm über die Aufbruchstimmung der Wendezeit, die Herausforderungen von Fusionen und die Notwendigkeit Neuer Musik.
Wie erinnern Sie sich an die Zeit der Wiedervereinigung?
Ekkehard Klemm: Im ständig klammen Staat DDR fand Kultur immer auch auf dem platten Land statt – einerseits als Aushängeschild, andererseits als Bildungsauftrag. Fragen Sie mich nicht, wie diese lebensfähigen Strukturen bezahlt wurden. Ich war seit 1988 Chefdirigent am Greifswalder Theater, nachdem ich in Altenburg begonnen hatte. Den Umbruch habe ich dann eher als Aufbruch erlebt, es war vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Wir hatten ganz basisdemokratische Vorstellungen, wie das Theater zu leiten sei. Da ging ein großer Ruck durch das Ensemble, es war eine quasi gesetzlose, optimistische Zeit.
Verflog der Optimismus, als Sie mit dem Stralsunder Theater zusammengingen?
Klemm: Es war schnell klar, dass wir fusionieren müssen, um überhaupt überleben zu können. Immerhin waren 1994 kaum Kündigungen notwendig, niemand wurde in völlige Armut entlassen, und das Orchester blieb mit großer Literatur sehr leistungsfähig. Aber es brachen auch Publikumsstrukturen weg. Die Lebenssituation gerade in Mecklenburg erforderte bei vielen ganz andere Prioritäten als die Kultur. Und wegen 15.000 Mark Subvention wurden die Bustransfers von der Insel Usedom gestrichen – damit waren 200 Abonnenten weg und kamen nie wieder.
Sind Sie heute noch der Meinung, dass ein Theater oder Orchester basisdemokratisch geführt werden kann?
Klemm: Ich glaube heute, das funktioniert nicht. Die Frage stellte sich auch nicht, denn als einer der wenigen Dirigenten aus dem Osten, die übrigblieben, stand ich neuen Verwaltungsmitarbeitern aus dem Westen gegenüber. Die brachten natürlich ihre eigenen Vorstellungen mit, was sicher auch notwendig war, um einen funktionierenden Kulturapparat zu steuern. Eine Bedingung der Fusion war für mich damals die künstlerische Perspektive: dass es möglich sein muss, danach höherwertig künstlerisch zu produzieren als vorher. Aber meistens steht ja bei strukturellen Veränderungen die Kunst ganz im Hintergrund. Ein weiteres Problem war lange Zeit die Überalterung der Ensembles, die sich automatisch ergibt, wenn die vorhandenen Stellen immer weiter abgeschmolzen werden und dies sozialverträglich passieren soll. Sogar im MDR-Sinfonieorchester in Leipzig wurden deswegen jahrelang keine neuen Musiker eingestellt, es fehlten existenziell junge Kräfte.
Wofür braucht man die so sehr?
Klemm: Es ist völlig normal, dass Sie ein anderes künstlerisches Ergebnis bekommen, wenn mit 63 Jahren an der 1. Geige Schulter und Rücken wehtun. Da spielt man natürlich nicht so, als wenn man frisch von der Hochschule kommt. Man braucht eine gute Mischung zwischen jungen Virtuosen und erfahrenen Spezialisten, die die eingespielten Mechanismen des Theaterbetriebs und die Orchester-DNA genau kennen. Diese Koexistenz erzeugt im Ensemble eine natürliche, produktive Konkurrenz. Davon leben auch die großen Spitzenorchester.
Hat in diesem Sinne auch die Elbland Philharmonie die Talsohle durchschritten?
Klemm: Auch bei uns finden inzwischen wieder Probespiele und Neueinstellungen statt. Das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann, weil die jungen Musiker eine neue Energie ins Orchester bringen. Dabei möchte ich niemandem unter den altgedienten Kollegen zu nahe treten: Sie verdienen höchste Anerkennung, auch vor dem Hintergrund der psychologischen Herausforderungen, denen sie über Jahre hinweg ausgesetzt waren.
Die ständige Angst um den eigenen Arbeitsplatz steckt man nicht einfach so weg.
Klemm: Für die Soloensemblemitglieder kleinerer Bühnen ist die Situation noch viel krasser, weil sie nach vierzehn Jahren Verpflichtung auf der Straße stehen und froh sein müssen, noch irgendwo in einer Musikschule unterzukommen, weil es für eine Professur nicht reicht und die große Karriere auch nicht mehr kommt.
Sie fahren mit Ihrem Orchester weiterhin übers platte Land. Ist es trotz alledem nicht doch gelungen, wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten?
Klemm: Dass noch so viel übrigblieb, ist bei Lichte betrachtet durchaus ein Wunder. Und gerade die Corona-Zeit zeigt uns nun, dass wir aus den Erfahrungen gelernt haben und unsere Chancen nutzen können. Dieser Motivationsschub hat zu neuen Stückideen geführt, anderen Besetzungen, vielen kammermusikalischen Aktivitäten. Mehr als zehn unterschiedliche Gruppierungen unseres Orchesters sind in allen Landkreisen gewesen und haben viel Anerkennung erfahren. Das ist schon eine neue Form von Vitalität.
Ihr sogar von einem Bundesförderprogramm geadeltes Faible für die Neue Musik, die Sie auch in 10.000-Einwohner-Städten pflegen, haben Sie nicht aufgegeben.
Klemm: Ich wünsche mir schon immer mehr Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Formaten und Inhalten. Ohne eine auch inhaltliche Erneuerung wird die Erhaltung der kulturellen Struktur Schwierigkeiten haben, sich weiter zu legitimieren. Naturgemäß blickt unser Publikum gern zurück, das war schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so. An Neue Musik ist es wenig gewöhnt. Aber steter Tropfen höhlt den Stein, und die Reaktionen auch auf dem flachen Land stimmen mich hoffnungsvoll. Man fährt ja auch die neuesten Autos, benutzt die aktuellen technischen Geräte oder geht zur documenta nach Kassel. Was gibt es Wichtigeres, als auf die Stimmen unserer Zeit zu hören?