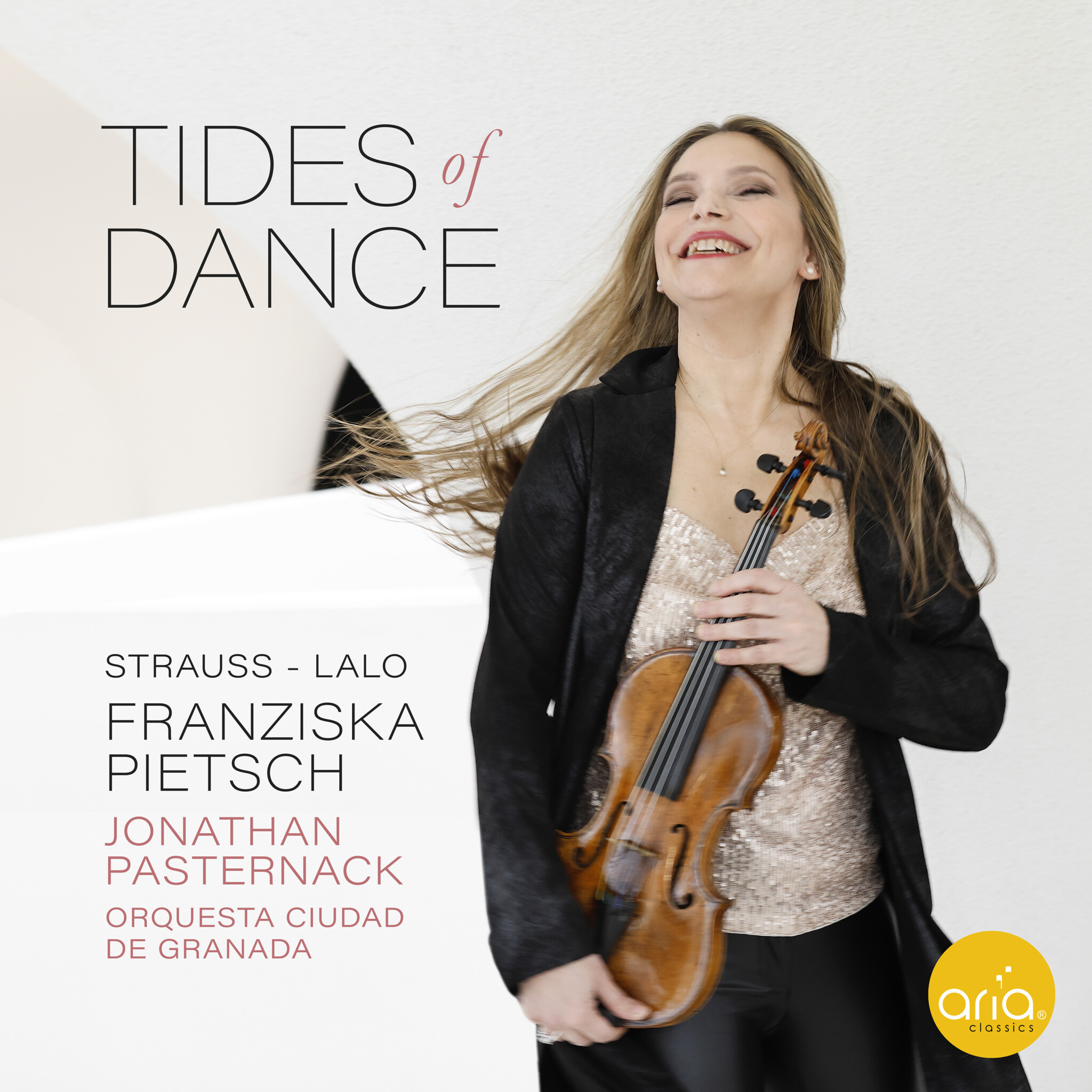Wolfgang Hentrich, Jahrgang 1966, begann 1987 als Erster Konzertmeister der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz, bevor er 1996 Koordinierter Konzertmeister der Dresdner Philharmonie wurde. Der Professor an der Dresdner Musikhochschule leitet nicht nur das Philharmonische Kammerorchester Dresden, sondern seit 2013 auch die Deutsche Streicherphilharmonie – eine gelungene Jugendorchesterfusion von hochbegabten Musikschülern Ost und West. Im Interview lässt der Dresdner Geiger ihre Erfolgsgeschichte Revue passieren.
Sie haben noch in der DDR Ihre erste Musikerstelle angetreten. Was sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit?
Wolfgang Hentrich: Ich habe eine hervorragende Ausbildung an der Dresdner Spezialschule für Musik genossen, die ich an der Musikhochschule Dresden fortgesetzt habe. Eine Triebfeder von Kindheit an war es dabei für mich, in ein Orchester zu kommen, mit dem man ins westliche Ausland reisen konnte. So fing ich im heutigen Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, bei der Robert-Schumann-Philharmonie an und durfte mit ihr wirklich nach Salzburg, West-Berlin und Saarbrücken fahren. Da war die Euphorie entsprechend groß. Nach der Wende trat aber relativ rasch eine gewisse Ernüchterung dazu – im Osten wurden nun zahlreiche gute Orchester verkleinert, fusioniert oder gar ganz geschlossen. Das tat sehr weh.
1997 wechselten Sie als Konzertmeister zur Dresdner Philharmonie. Hatten Sie je Angst um Ihre Stelle?
Hentrich: Ich bin mir meines riesigen Glückes sehr bewusst, dass ich beruflich nie Zukunftsängste erleben musste: Im klassischen Orchestermusikberuf hat sich durch die Wende eigentlich nichts geändert. Die Musik war dieselbe, und unser Studium wurde auch im wiedervereinigten Deutschland ohne Abstriche anerkannt. Schon vor der Wende spielten unsere besten Orchester international an der Spitze mit. In anderen Berufen hatten es da viele in der DDR ausgebildete Menschen bedeutend schwerer.
2013 übernahmen Sie zusätzlich zu Ihren vielfältigen Aktivitäten als Musiker auch noch die musikalische Leitung der Deutsche Streicherphilharmonie. Warum?
Hentrich: Seit dem ersten Moment unserer Zusammenarbeit fasziniert, beeindruckt und berührt mich auch immer wieder, wie sehr sich diese jungen Menschen selbst motivieren, was sie leisten wollen. Immerhin sind wir ja mit unseren ambitionierten Konzertprojekten in bedeutenden Sälen zwischen Wien und Berlin zu Gast. Die Jugendlichen zwischen elf und zwanzig Jahre stehen dafür sechs Stunden lange, intensive Proben pro Tag durch und müssen perfekt vorbereitet kommen. Dabei sind die Stücke manchmal für die Jüngsten technisch oder emotional eigentlich zu schwer, aber sie werden mitgezogen und machen damit die Erfahrung, dass sie sich in der Gemeinschaft viel schneller verbessern, als es ein Zwölfjähriger zu Hause kann. Darauf kommt es an. Und da geht es eben gerade nicht um einfache Bespaßung, sondern um echte künstlerische Herausforderungen und das persönliche Maximum an Leistungsbereitschaft.

Warum wird die Deutsche Streicherphilharmonie als Musikschulorchester gern als Kind der Wiedervereinigung bezeichnet?
Hentrich: Eigentlich ist es ein Kind der DDR, denn es wurde hier 1973 als Rundfunkmusikschulorchester gegründet. Antrieb dieser Kulturpolitik war ja wie beim Leistungssport immer die gewünschte Anerkennung von außen und die Förderung nach innen. Von Anfang an wurden so die besten Musikschüler des Landes auf professionellem Niveau von Mentoren des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin betreut. Nach 1990 stand das Orchester dann wie so vieles in der ehemaligen DDR zur Disposition. Angela Merkel hat es dann als gesamtdeutsches Ensemble in die Trägerschaft ihres Familienministeriums übernommen, wo es noch heute angesiedelt ist. Eine mutige, zukunftsweisende Entscheidung.
Nun spielten also Musikschüler aus allen Landesteilen zusammen.
Hentrich: Das war die Idee und Bedingung. In beiden Teilen Deutschlands gab und gibt es ein sehr gutes Musikschulsystem. Auch in den entlegensten Gegenden kann man Instrumente, Gesang oder Balletttanz lernen. So ist mit der Deutschen Streicherphilharmonie etwas gelungen, was wir uns auch für die beiden deutschen Staaten erhofft hatten: eine Vereinigung durch gegenseitige Annäherung.
Sehen Sie heute noch Unterschiede bei Ihren Musikern?
Hentrich: Eher nicht, aber in ihrer musikalischen Ausbildung schon. Indirekt sind auch heute noch die jeweiligen pädagogischen Konzepte spürbar: Die DDR-Ausbildung war oft vom russischen Leistungsprinzip mit starker Autorität und Auslese geprägt. Im Westen dagegen war der Ansatz wohl eher, sich frei zu entwickeln, sich auszuprobieren. Die höhere Kreativität ging hier manchmal zulasten theoretischer Grundlagen. Es ist doch so: Will man Musik ergründen und kann ihre Struktur nicht verstehen, wird man kein guter Musiker. Andersherum vertrocknen jene, die nur Tonleitern üben und auf das Prinzip „höher, schneller, weiter“ getrimmt werden. Hier finden West und Ost auf wunderbare Weise zusammen, weil sie beide Ausbildungstraditionen zu gleichen Teilen einbringen.
Wie funktioniert das: Sie dirigieren, die Mentoren des Rundfunkorchesters trainieren?
Hentrich: Vor den Gesamtproben, die ich leite, gibt es die einzelnen Registerproben. Die Mentoren setzen sich mit ans Pult und geben dabei wesentliche technisch-musikalische Hinweise. Mit einem immensen Zeitaufwand wird wirklich jedes Detail einstudiert. Dieses aufopferungsvolle Wirken der Kollegen ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.
Warum ist Ihnen die anstehende Tour so wichtig?
Hentrich: Wir weisen damit ja nicht nur auf das Einheitsjubiläum, sondern auch auf unsere eigene erfolgreiche Geschichte hin. Und wir möchten darum werben, die gemeinsamen Werte zu leben: aufeinander hören, sich miteinander große Ziele setzen und sie auch erreichen, sich in eine Gemeinschaft einordnen wollen, Grenzen überwinden. Leider werden wir grundsätzlich nur für nationale Aktivitäten gefördert, so dass Auslandsreisen eine Herausforderung sind, für die wir mehr Sponsoren bräuchten. Diese jungen Menschen sind fantastische Kulturbotschafter und Zeugnis einer gelungenen Wiedervereinigung, und so wäre nicht nur unser Europa, sondern auch die koreanische Halbinsel eine Reise wert.