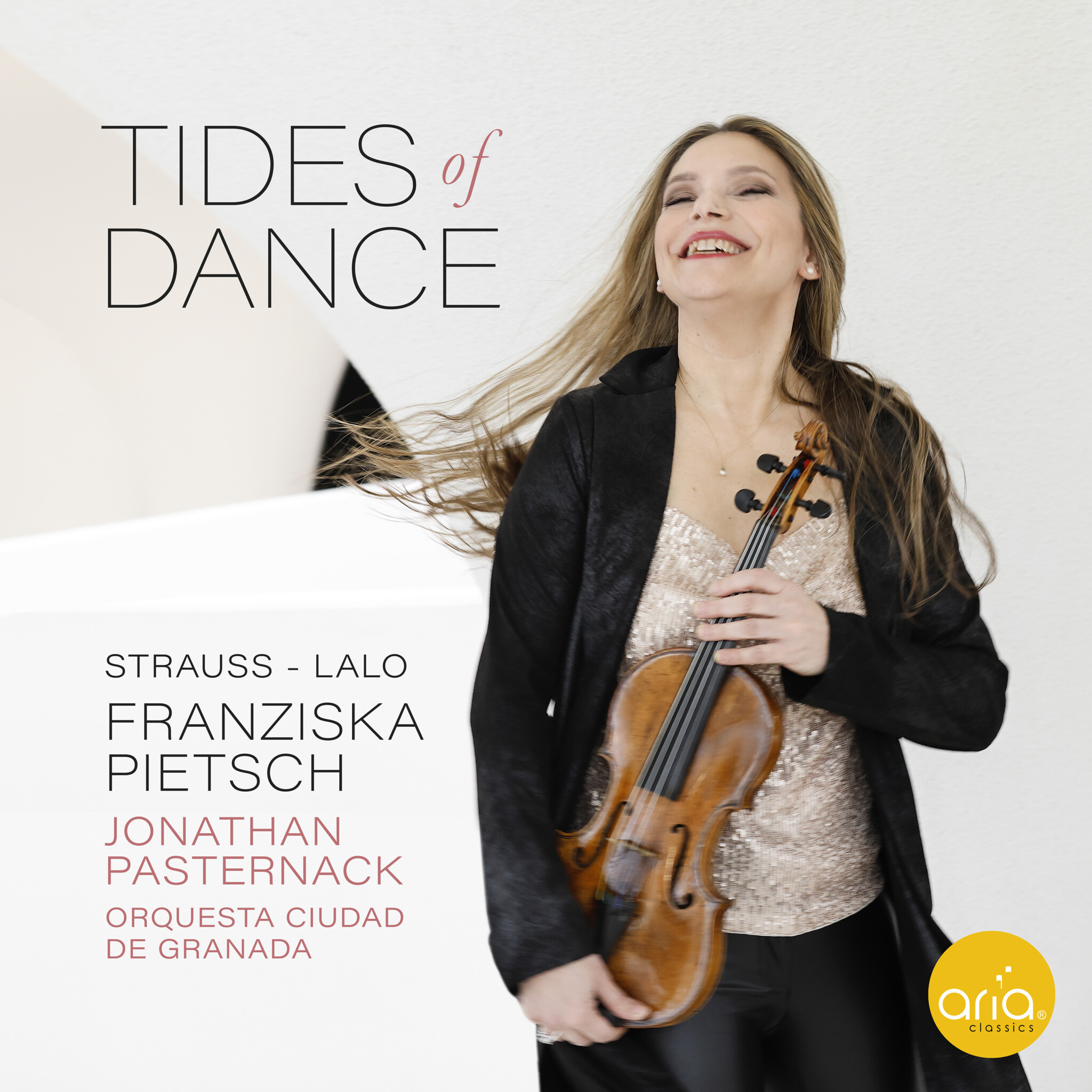Seit einigen Jahren erschließt die Weimar-GmbH als stadteigene Marketinggesellschaft das Tourismus- und Kulturformat „Bach in Thüringen“. Die Inhalte hat man übersichtlich gegliedert: Weimar, Eisenach und Erfurt sind in „Deutschlands grünem Herz“ die städtischen Hotspots für Luther, Bach, Goethe und für die Sparten Reformation, Musik, Klassik. Es gibt einen Goethewanderweg von Weimar nach Großkochberg, es gibt die Bach-Rad-Erlebnisroute und das Netz des Thüringer Lutherwegs mit insgesamt 900 Kilometern. Doch dieser fokussierte Tourismus erfasst nur einen Teil der verwirrenden Dichte musikhistorischer Spuren: Gedenkorte bleiben unerschlossen oder werden durch die Konzentration auf die prominenten Persönlichkeiten und Ereignisse vernachlässigt. So lässt die Leitung der Thüringer Bachwochen ausschließlich an für die Musiker-Dynastie Bach relevanten Orten konzertieren. Wandersleben rutscht aber aus dem Fokus, obwohl dort ein gar nicht so unbedeutender Autor von Bachs Kantaten-Texten geboren wurde. Zudem – Hand aufs Herz: Wer nimmt sich an einem halben Tag mit zwei Konzertbesuchen, die an mehr als vierzig Kilometer voneinander entfernten Räumen stattfinden, Zeit zur Erkundung von Orten mit viel stiller Aura, aber ohne Gastronomie? Deshalb lohnt es sich, für eine musikalische Spurensuche die Landgemeinde Drei Gleichen zum Ausgangspunkt zu nehmen.
An diesem im Wortsinn fabelhaften Flecken zwischen Erfurt, Arnstadt und Gotha kann man gut zwei Tage mit Besichtigungen oder Wandern verbringen. Seit der Romantik gilt das Bergensemble mit den Gleichenschlössern als Thüringens bedeutendster Sagenschauplatz – neben der Wartburg und dem Kyffhäuser. Doch nur in Richard Wagners Oper endet Tannhäusers Aufenthalt bei der heidnischen Göttin Venus im von der Wartburg zwölf Kilometer entfernten Hörselberg mit himmlischer Erlösung. Die meisten früheren Varianten des Stoffes berichten von Tannhäusers resignativer Flucht vor der ihn verdammenden Welt in den Hörselberg. Dagegen erhielt der Graf von Gleichen für seine Gemeinschaft mit einer deutschen Christin und der ihn aus der Gefangenschaft rettenden Sultanstochter sogar die Zustimmung des Papstes. Ihre letzte gemeinsame Ruhestätte fand diese interkulturelle Dreiecksbeziehung unter einer Steinplatte im Dom von Erfurt.
Trotz einiger Bearbeitungen wird es Franz Schuberts unvollendete und erst 1996 in Meiningen uraufgeführter Oper „Der Graf von Gleichen“ nicht mit „Tannhäuser“ aufnehmen können. In der DDR war der Stoff immerhin so bekannt, dass Gerd Natschinski mit seinen Autoren Helmut Bez und Jürgen Degenhardt die pikante Konstellation für die sozialistische Gegenwart von 1973 aufgriff – ohne böses Ende allerdings wie Goethe in einer der beiden Fassungen seines Schauspiels „Stella“: Im Musical „Terzett“ sind es der Archäologe Florian, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Otti und die Ägypterin Leila, die bei einem Besuch auf den Drei Gleichen romantische Gefühlsverwirrung als menschliche Herausforderung meistern. In der Erinnerung vieler blieb „Terzett“ lebendig, während Peter Franks Musical „Der Graf von Gleichen – Die Geschichte einer Liebe“ auf Gut Ringhofen bis 2008 gerade zwei Spielsommer schaffte.
Musikalisches Kraftfeld
Für Musikreisende ist die Region Drei Gleichen heute Kraftfeld der Familie Bach. Dabei war Mittelthüringen vom späten 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert auch ein Zentrum der Adjuvanten (lat. Helfer), die als Sänger und Instrumentalisten die Gottesdienste in Städten und kleinen Pfarreien auf bemerkenswert hohem Niveau bereicherten. Die noch nicht vollständig gesichteten Adjuvanten-Verzeichnisse und -Bibliotheken aus Thüringen enthalten Abschriften von Kompositionen lokaler Provenienz, deren künstlerischer Wert erst in jüngster Zeit gewürdigt wird. Repertoire und Anspruch unterschieden sich bis an den Beginn des 19. Jahrhunderts in großen und kleinen Kantoreien kaum. Die Academia Musicalis Thuringiae veröffentlicht im Editionsprojekt „Musikschätze in Thüringen“ Kompositionen des 16. bis 18. Jahrhunderts
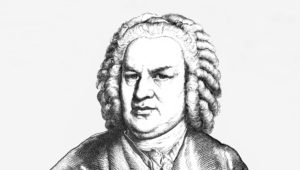
Neben dem Festival Güldener Herbst, das vor allem der Musik aus Höfen und Residenzen gewidmet ist, veranstaltet sie seit 2011 überdies an wechselnden Orten die Thüringer Adjuvantentage, so 2013 in Wandersleben und in dem nur 45 Fußminuten davon entfernten Flecken Apfelstädt. Es setzt nicht in Erstaunen, dass um 1725 Werke des Gothaer Hofkapellmeisters Gottfried Heinrich Stölzel im Kirchen des Umkreises aufgeführt wurden. Umso beeindruckender ist es, dass zum Beispiel in Udestedt nördlich von Erfurt Aufführungen aus Abschriften der Werke von in weiter Ferne wirkenden Komponisten wie Andrea Gabrieli, Orlando di Lasso und John Dowland stattfanden. Prof. Bernhard Klapprott, Direktor des Instituts für Alte Musik der Hochschule für Musik Weimar, setzt sich für die Edition und Aufführung von Entdeckungen aus den Adjuvanten-Archiven Thüringens ein. Mit Christoph Dittmar leitet er das auch auf dieses Repertoire spezialisierte Doppelensemble Cantus Thuringia & Capella.
Im auf der Bachroute nicht genannten Ort Wandersleben befindet sich die Gedenkstätte für den Schriftsteller Christian Friedrich Hunold, der vor Gläubigern nach Hamburg fliehen musste und dort unter dem Künstlernamen Menantes zum Bestseller-Autor wurde. Aus Hunolds Feder stammt neben pikanter, dem Zeitgeschmack huldigender Prosa und Texten zu einigen Köthener Kantaten Johann Sebastian Bachs das Libretto zu dem opernnahen Oratorium „Der blutige und sterbende Jesus“ für die Zuchthauskirche Hamburg (1704). Die Komposition schuf Reinhard Keiser aus dem 110 Kilometer entfernten Teuchern, der in Hamburg Händels und Telemanns wichtigster Vorgänger wurde.
Eintauchen in die Bach-Familie
Um die Landgemeinde Drei Gleichen kommt man dem Geist der Bachzeit näher als in den Städten. Heute gehört Dornheim, wo Bach in der gerne als Konzertort genutzten Traukirche St. Bartholomäus seine Cousine Barbara heiratete, zu Arnstadt. Wechmar war der Wohnort des Müllers Veit Bach und seines Sohnes Simon Bach, die als Stammväter der Bach-Familie gelten. Eine spekulierende Ursprungsgeschichte leistete sich nicht nur Volker Hagedorn in seinem Buch „Bachs Welt. Die Familiengeschichte eines Genies“. Besser noch als in der Residenzstadt Ohrdruf lässt sich bei einem Besuch von Wechmar in die Lebensbedingungen von Bachs Familienangehörigen eintauchen. Im Bach-Stammhaus (oder Oberbackhaus) befindet sich seit 1994 eine Gedenkstätte. Ein Teil der neuen Dauerausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“ im dortigen Schlossmuseum ist dem religiösen Leben um 1700 gewidmet.
Noch heute setzt es in Erstaunen, dass Johann Sebastian Bach seine singuläre kompositorische Meisterschaft entwickelte, ohne das Gebiet Mitteldeutschlands mit Ausnahme von Reisen nach Hamburg, Lübeck und Karlsbad verlassen zu haben. Die Thüringer Kleinmuseen und Fundorte neben den „Wegen zu Bach“ machen verständlich warum: Die Adjuvanten-Musik dieser Region hatte nach heutiger Kategorisierung Weltformat. Die Sage über den Kreuzritter, der als polyglotter Kosmopolit seine Liebe zwischen einer deutschen und einer fremdländischen Frau teilte, oder der Sängerkrieg auf Wartburg, zum dem sich nach einer anderen Sage die bedeutendsten mitteleuropäischen Poeten des Hochmittelalters einfanden, beschwören ein weltläufiges Selbstverständnis dieses Landstrichs, der mit der heutigen Definition urbaner und nicht-urbaner Kulturräume unverständlich bleiben muss. Auch ohne Festivals wird die Erkundung zu einem kleinen kulturellen Sommerabenteuer.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen