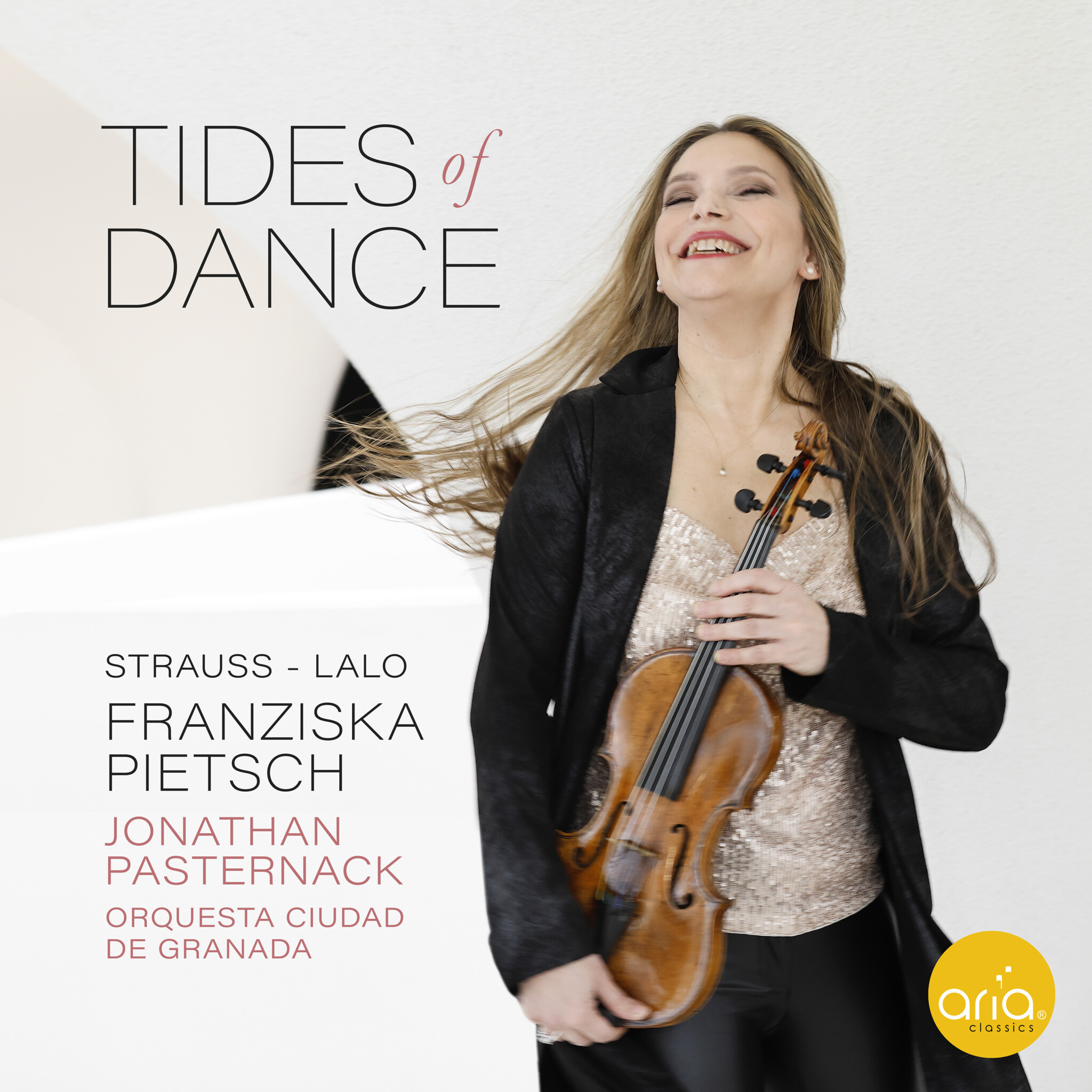Kultur ohne Mindestabstand – das klingt nach einer ungewohnten, fast provokativen Vorstellung. Doch genau das ist das klare Ziel, das Politik, Kulturveranstalter und Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren dürfen: „Ich habe die Befürchtung, dass wir uns in Zwischenstufen und Zwischenschrittchen verlieren und diese schlimmstenfalls für die Lösung halten“, sagt Uschi Neuss, Geschäftsführerin des Veranstaltungsunternehmens Stage Entertainment.
Bei dem am gestrigen Nachmittag abgehaltenen, von Stage Entertainment ins Leben gerufenen Symposium „Kultur ohne Mindestabstand“ steckt das diskutierte Thema schon in der Überschrift. Die seit März 2020 mit wenigen Ausnahmen stillstehende Live-Kultur in Deutschland brauche eine Perspektive und einen Plan zur Wiederöffnung – ohne zwischenmenschliche Abstände. „Live-Erleben, Kultur und Mindestabstand, das geht nicht zusammen“, so Neuss. Es sei wider alle Menschlichkeit.
Kontakte dürfen nicht verhindert werden, sie müssen sicher sein
Moderiert von Julia Westlake haben sich sechs Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen online zusammengefunden, um gemeinsam über Ideen, Möglichkeiten, Strategien zur Wiederaufnahme des Live-Entertainmentbetriebs in Deutschland zu diskutieren. Der Grundtenor der Runde schälte sich schnell heraus: Wege und Möglichkeiten sind da, sie müssen nur genutzt werden. Eine weitere Einigkeit: Lockdown auf Lockdown folgen zu lassen sei keine Lösung, sondern schade Staat, Gesellschaft und Demokratie. Kultur darf nicht aus Prinzip geschlossen bleiben, man muss sie dort öffnen, wo es möglich ist, damit sie nicht auf Dauer verloren geht. Die Politik braucht dafür neue Ansätze.
„Ziel muss es daher sein, Kontakte nicht teuer – durch Lockdowns – zu verhindern, sondern Kontakte mit Technik sicher zu machen“: Der Lehrstuhlinhaber für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Münchner Bundeswehr-Universität, Prof. Christian Kähler, pocht auf die häufig noch ausgebremste Ausschöpfung technischer Konzepte mit Luftreinigern, -filtern oder Schutzwänden. Die indirekte Infektion, also die Infektion durch im Raum befindliche Aerosole, sei in Veranstaltungssälen durch ihre Größe und ihren in der Regel ausgezeichneten Belüftungssystemen äußerst unwahrscheinlich. Das Rein- und Rausgehen müsse geregelt werden, die Schließung der gesamten Institutionen sei indes kontraproduktiv.
„Gesundheit ist auch geistiges Wohlergehen“
Dem Einsatz neuer technischer Möglichkeiten pflichtet auch der Hamburger Kulturmanager Axel Strehlitz bei, der die App „Freepass“ entwickelt hat. Registrieren, testen, ausgehen – das sind die Schlagworte der App. Sie soll negativ getesteten und damit für rund 36 Stunden nicht ansteckenden Nutzern den Zugang zu Veranstaltungen gewährleisten: „Durch die Nutzung dieser App werden bei Veranstaltungen gewissermaßen coronafreie Inseln ohne Mindestabstand geschaffen, weil keiner der Anwesenden während des Events infektiös ist“, so Strehlitz.
Wichtig sei, dass etwaige Coronatests, die einem den Zugang zu Live-Veranstaltungen verschaffen sollen, durch professionelles Personal durchgeführt werden. So sieht es Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit. Selbsttests seien nicht manipulationssicher, dadurch nicht zuverlässig genug. Grundsätzlich hält auch er die Schließung der Kulturszene für keine langfristige Lösung, denn „Gesundheit ist nicht nur körperliches Gebrechen, Gesundheit ist auch geistiges und seelisches Wohlergehen.“ Dafür brauche es auch Kultur.
Appelle an die Politik
Die Nachfrage seitens des Publikums ist da: Alexander Ruoff von Eventim stellt ermutigende Umfragen vor, nach deren Ergebnis sechzig Prozent der Befragten sofort, dreißig Prozent innerhalb von sechs Monaten nach offizieller Genehmigung wieder Live-Events besuchen wollen. Er appelliert an die Politik, Perspektiven und Planungssicherheiten mit Vorlauf zu bieten, etwa durch Stufenpläne, wie es schon in Großbritannien und Israel der Fall ist.
Auch Dänemark wird genannt: Dort orientiert man sich weniger an den Inzidenzzahlen und stattdessen an Morbiditäts- und Mortalitätsraten, die sich auf schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle beziehen. In erster Linie gelte es laut Philosoph Julian Nida-Rümelin, genau diese Werte auf ein geringes Maß zu drücken. Ein Handlungsappell an die Politik, die der Entwicklung neuer Konzepte zurzeit eher entgegenwirkt statt sie zu fördern, kommt auch von ihm: „Die öffentliche Debatte muss unsere Politiker ermutigen, guten Konzepten zu folgen.“
Ein weiteres Symposium zum Thema „Kultur ohne Mindestabtand“ findet am 5. Mai 2021 statt.